„Ist die Wahrheit zumutbar?“
Des „Hungermalers“ Suche nach absoluter Schönheit
Nach ihrem ausladend erzählten Roman „Brüchige Ufer“ schlägt die im Burgenland lebende Südtiroler Autorin Helene Flöss mit ihrem Text „Der Hungermaler“ einen völlig neuen Ton an, der stilistisch wie erzähltechnisch überrascht: Auf die detaillierte Studie innerfamiliärer Beziehungen, die auch als ergiebige Sozial- und Kulturgeschichte des Burgenlands ihren Wert hat, folgt mit dem „Hungermaler“ eine schlanke, fast asketische Erzählung, die sich – auf den ersten Blick – mit einer Liebesgeschichte begnügt. Bei genauerem Hinsehen allerdings ist viel Gemeinsames mit dem Familienepos zu entdecken: Da wie dort ist Eisenstadt ein zentraler Schauplatz, da wie dort lässt eine tragische Mutter-Sohn-Beziehung einen Mann zerbrechen, und da wie dort erweisen sich die Ufer, an denen Menschen ihr Leben einzurichten versuchen, als brüchig.
Was wird erzählt? Der Kunsterzieher und Maler Peter Franz ist schon in seiner Schulzeit ein „Randseitiger, ein Sonderling“, ein „Genie, das schwer am eigenen Leben trägt“ (S. 28). Einsamkeit ist „sein Ausdruck für die niedergehaltene Auflehnung gegen alles“ (S. 14). Als Jugendlicher gerät der begnadete Zeichner, der von sich meint, „er habe gezeichnet, noch bevor er gehen lernte oder sprechen“ (S. 24), durch Zufall in den Bann des toskanischen Frührenaissance-Malers Piero della Francesca (geboren um 1420 – gestorben 1492), der ihn fortan nicht mehr loslässt und die bestimmenden Koordinaten seines Lebens festlegt.
„Er sagt, es gäbe nur das Eine, wofür es sich zu leben lohne: die Schönheit. Er lebe für die Schönheit. Einzig und allein für die Schönheit. Das Gleichnis der Vollkommenheit. Den Abglanz des Göttlichen. Er, Piero, der Diener der Schönheit und ihr Vermittler. Die Schönheit der Symmetrie, die Schönheit des Klanges. Und die Schönheit der Frau als deren letztendliche Krönung. Dies sei sein Anspruch.“ (S. 26)
Mit der Kunstweberin Magdalena, seiner „Penelope“, verbindet ihn nicht nur die bildende Kunst, sondern bald auch eine ambivalente Liebe. Nach einem zunächst beglückenden Eintauchen in eine gemeinsame Welt der Bilder, Musik und Erotik genügt die Weberin bald nicht mehr seinen Ansprüchen an ein Modell: Um seiner Vorstellung von vollkommener weiblicher Schönheit zu entsprechen, müsse ihr Körper in seinen Formen weicher und runder werden.
„Warum sich ihr vollkommenes Gesicht nicht in einem ebenso vollkommenen Frauenkörper fortsetze, fragt er, in einem runden, weichen, üppigen.“ (S 76)
Zwar lässt sich Magdalena auf die eine oder andere Maßnahme ein, um ihrem mageren Körper einen Hauch von Üppigkeit zu geben, als er aber unerbittlich sein Ideal über die Geliebte stellt, bekommt die Beziehung Brüche und verdorrt.
Damit aber nicht genug: Der Hungermaler selbst wird seinen eigenen selbstquälerischen Ansprüchen nicht gerecht, wenn es um die Pflege seiner harten, lieblosen Mutter geht. „Eine Kunst, die kein Mitleid kenne, sei keine“ (S. 82), meint er. Zerrissen zwischen seinem Scheitern als Künstler wie auch als Sohn vereinsamt er, übergibt all seine Skizzen dem Feuer, setzt dem Leben seiner Mutter ein Ende und wird wegen Sterbehilfe verurteilt. Nach der Haftstrafe – für die webende Penelope fünf lange Jahre des ungewissen Wartens – könnte der Boden für eine harmonische Beziehung ein wenig fruchtbarer geworden sein. Gewiss ist das aber nicht.
Erstaunlich geschickt zeichnet Helene Flöss auf knapp 110 Seiten ein Lebensbild, wobei die Haftentlassung nicht bloß als Neugier weckender Einstieg und strukturierender Fluchtpunkt dient, sondern auch als Motor für den analytischen Erzählvorgang.
Vordergründig eine exzentrische Liebesgeschichte besticht die Erzählung durch ihre thematische Dichte, die einen weiten, aber schlüssigen Bogen vom Wesen der Kunst bis hin zu aktuellen Fragen der Altenbetreuung spannt. Peter, in Anspielung an das Renaissance-Vorbild von Penelope liebevoll „Piero“ genannt, scheitert als Maler, weil er nicht akzeptieren kann, was Ingeborg Bachmann die „unbegreifliche Auszeichnung des Menschen“ nennt, dieses „Widerspiel des Unmöglichen mit dem Möglichen“. Der Hungermaler weigert sich, mit dem Unvollkommenen zufrieden zu sein, verliert sich in Skizzen und zerstört eine viel versprechende Liebe. Schon früh im Text taucht Sisyphus auf, Sinnbild für Pieros künstlerisches Streben:
„Sein ganzes Leben sei er immerzu mit jedem Entwurf unzufrieden. Sein ganzes Leben sei er immerzu auf der Suche. Immerzu gäbe es da etwas, das sich dem Entschluss widersetze, das der Festlegung entgegenlaufe. Die Selbstzufriedenheit des Ästheten sei ein Widerspruch in sich selbst. Und die Forderung, sich für eine Version entscheiden zu müssen, käme einer Vergewaltigung gleich. Tausende von Proben. Unermüdliches Zeichnen. (…) Sein Skizzenbuch verfolgt sie wie ein Alb. Vom Bett aus hatte sie ein Blatt vor Augen. Sisyphus. (S. 10 und 19)
Magdalena lebt das Gegengewicht. Sie weiß, dass es ein Überschreiten der Grenzen nicht gibt, auch wenn der Blick auf das Vollkommene präsent ist, und verklärt in ihren Tapisserien „das Alltägliche zur feierlichen Schöpfung“ (S. 74). Sie ist zu jener Langmut fähig, die Penelope auf Odysseus warten lässt.
„Sie ist eine gute Handwerkerin. Fleißig, vertieft. Sie sitze vor ihrem Webstuhl wie ein Organist vor seinem Instrument, sagt er. Verspielt, verträumt und zugleich so ernst, so entschieden. Ein Versunkensein. Eine Vertrauensseligkeit, als sei sie noch nie einer Enttäuschung begegnet.“ (S. 21)
Tragisch, ja grausam wird die Beziehung, als der Maler sein Bild von Magdalena über diese selbst stellt und damit ihr beider „Verhungern“ riskiert.
Dass in Piero, diesem Sohn eines wortkargen Vaters und einer Mutter, die er nie weinen gesehen hat, schon in der Kindheit etwas folgenschwer zerbrochen ist, wird in seiner unseligen Beziehung zur Mutter erkennbar. Dieses Nicht-Loskommen-Können von der Mutter und akute Probleme der Altenbetreuung münden in eine zerstörerische Sackgasse, aus der der Maler als Ausweg nur noch die Euthanasie sieht. Im Töten der Mutter ist allerdings – so Andeutungen im Text – auch ein Schlag gegen die Geliebte zu sehen, die letztlich doch nicht bereit ist, ihr Sosein einer Idee zu opfern.
In Anspielung an die biblische Magdalena, die Jesus aus der Ausgrenzung zum Vorbild erhebt, ist es die Weberin, also eine Frau nicht ohne Makel, die für die Konturen eines Wertesystems sorgt. Und sie ist es auch, aus deren Perspektive die Geschichte erzählt wird. Immer wieder massive Raffungen setzend verknüpft die Autorin vorwiegend assoziativ die einzelnen Episoden, die sich schließlich wie Mosaiksteine zu einem Bild zusammenfügen.
Mosaiksteinartig ist auch die Sprache. Zwischen schlichten Parataxen lassen elliptisch radikal verkürzte Wortkompositionen einen Stil entstehen, der an flüchtig gesetzte Pinselstriche erinnert und zum Sinnbild für die Brüchigkeit der skizzierten Welt wird.
All das macht den „Hungermaler“ zu einem vielseitig lohnenden Buch, das Leser wie Leserin über Kunst und Beziehungen nachdenken lässt und – möglicherweise – auch auf eine Reise schickt, und zwar auf die Spuren jene Piero della Francesca, der nach Jahrhunderten noch die Kraft hat, das Leben des Hungermalers und dessen Liebe zu Penelope zu bestimmen.
Herbert Först
Textprobe:
Nur große Künstler können scheitern, Piero.
Dann schlägt er ein Abkommen vor. Er male ein Bild für ein Kilo Gewicht von Penelope. Fünf Bilder, fünf Kilo.
Was für ein denkwürdiger Pakt, mein Maler. Dein Ungenügen an der Frau, die ich dir geworden bin – die dir alle einmal geworden sind – und die Vorläufigkeit deiner Arbeit. Gehört das zusammen?
Ihr vollendetes Gesicht und dieser zurückgenommene Körper. Der Körper einer Asketin. Es zerreiße ihn, sagt Piero. Er brauche die ganze Schönheit, die ganze. Er hungere danach. Er dürste. Warum sie ihm das vorenthalte, fragt er, das Weibliche.
Dora Maar, antwortet Penelope. Picassos Geliebte. Picassos Modell.
Was euch im Leben nicht zugänglich ist, euch Männern oder euch Ästheten, das macht ihr zum Gegenstand eurer Kunst. (S. 87)
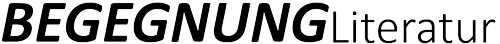
Kommentare sind deaktiviert