„Kann eigentlich eine Frau eine Frau heiraten?“
„Im Kokon“ – Selma Mahlknechts Erzählung über eine schmerzvolle Selbstfindung
„Als ich die Stimme zum ersten Mal hörte, hatte ich mir gerade im Gedörn den Oberarm geritzt. Ich war ins niedere Gesträuch, das ein Fichtenwäldchen umgab, gekrochen, um Pilze zu finden oder einen Fuchsbau oder wenigstens eine Maus, und nun rannen mir dünne Blutfäden den Ellbogen hinunter.“ (S. 7)
So eröffnet die aus Meran stammende Selma Mahlknecht ihre Erzählung und bereitet die LeserInnen behutsam auf eine Geschichte des Suchens, Verirrens, Entdeckens und Sich-Verletzens vor. Mit dem Titel legt sie auch das Programm des Textes auf den Tisch: „Im Kokon“ ist eine Erzählung über eine Metamorphose. Im Verlauf von etwa 15 Monaten durchbricht die Ich-Erzählerin, ein etwa zwölfjähriges Mädchen, den Panzer ihres Kindheitskokons und betritt nach schmerzvollen Erfahrungen befreiendes Neuland. Das Mädchen ist eine mittelmäßige, eher antriebsschwache Schülerin, die die unerfreulichen Mechanismen in Schule und Familie durchschaut, verachtet und mutig bekämpft. Als Sandwich-Kind hat sie es auch nicht leicht zuhause und so verbringt sie viel Zeit im Freien, wo die Natur, der Wald im Besonderen, immer wieder zu einem Raum der Selbstfindung wird. Waldszenen sind es auch, die dem Text einen symbolträchtigen Rahmen geben.
Erzählimpuls ist eine Stimme, die das Mädchen eines Tages in ihren Bann zieht. Sie gehört einer schwangeren Frau, die dem werdenden Kind in ihrem Bauch Einschlafgeschichten erzählt. Diese Stimme, das geheimnisvolle Ambiente des einsamen Hauses, die Geschichten und die offenkundige Zärtlichkeit der jungen Frau mit Namen Nelly – all das wirkt wie Magie auf die Protagonistin. Sie fühlt sich „wie verhext“ und ahnt eine „Ungereimtheit, die allmählich und für immer (ihr) Leben verbog“ (S. 15). Mit der magischen Kraft von Stimme und Geschichte verweist Selma Mahlknecht gleich zu Beginn auf die Zauberkraft von Erzählungen: Ähnlich Katalysatoren kann eine Erzählung, kann Literatur Veränderungen, Verwandlungen auslösen, beschleunigen, abschließen.
In einem ersten Gespräch mit Nelly bekommt die Ich-Erzählerin eine „Weltwahrheit“ (S. 19) vorgesetzt, die Neugier weckt und das Mädchen erschauern lässt: „Alle tun das, was sie tun, weil es notwendig ist. Sie wissen es nur nicht.“ (S. 18) Eine verschwommene Ahnung erfasst die Puppe im Kokon und erfüllt sie mit unbändiger Sehnsucht „nach Sicherheit, nach Letztgültigkeit“; in ihr regt sich der „Wunsch, unverrückbar fest zu stehen in der Welt, die ringsum dröhnt und scheppert und sich stets neu mit sich selbst überwirft“ (S. 19).
Nelly, die selbst auf der Suche nach alternativen weiblichen Lebensentwürfen ist, bestimmt im folgenden Jahr das Leben der Protagonistin, die von der Überzeugung getrieben wird, dass Liebe sie mit Nelly verbindet: „Da half kein Leugnen mehr. Das war die Liebe“ (S. 22) Das ist der Beginn einer heftigen Bindung, die im Mädchen auch homoerotische Gefühle auslöst. Auf zarte Anfragen im Familienkreis hat der Vater eine klare Antwort bereit: „Frauen lieben nur Männer, und basta.“ (S. 26) Das Mädchen ist erschüttert, steht doch die Lebensgemeinschaft mit Nelly in seinem Lebensplan, der die aufbrechende Erotik mit einschließt, bereits fest: „Zwei Zauberfrauen würden wir sein, im Einklang mit der Natur, barfuß tanzend im Wald. Noch musste ich so viel lernen, aber das Ziel stand mir klar vor Augen.“ (S. 29)
Vor der Ich-Erzählerin liegt nun ein mitunter quälender Weg körperlicher und geistiger Reifung durch ein Labyrinth von Gefühlen, Erfahrungen und Entdeckungen, der sie wiederholt in schwierige Situationen führt und in den dramatischen Umständen einer schwierigen Geburt, die Nelly an den Rand des Todes bringen, seinen Höhe- und Wendepunkt erreicht. An seinem Ende „bröckelt die Fassade“ an den „Luftschlössern“ der Pubertät (S. 152), das Mädchen löst sich von der einstigen „Zauberfrau“ (S. 153), fühlt sich befreit und mit Stolz erfüllt, hat es doch diese Metamorphose aus eigener Kraft geschafft. Die in diesem Sinne Neugeborene sieht die ihr nahen Menschen in einem anderen Licht, definiert sich neu und ist „berauscht“ von „der ziellosen Freiheit“, den „vielen Möglichkeiten“, von denen ihr Leben „nur eine“ sein würde (S. 166f.). Geschickt setzt die Autorin an das Ende ihrer Erzählung einen programmatisch zu deutenden Dialog: Aus dem einst belächelten „Klassenkaiser Holger“ ist ein wertvoller Wegbegleiter geworden, den der geschlüpfte Schmetterling an seiner Seite zu schätzen weiß.
Einfühlsam und treffsicher gestaltet Selma Mahlknecht diese Studie über eine pubertäre Krise und erweist sich als versierte Erzählerin, die verschiedene Formen des Erzählens gekonnt einsetzt: Der häufige Wechsel von Erzählerrede, inneren Monologen und knappen Dialogen hält den Text stets nah am Leben. Viel Reiz, Kraft und Anschaulichkeit bezieht die Erzählung von ihrer weitgehend authentischen Adoleszenzsprache. Nur selten blickt die Ich-Erzählerin aus größerer zeitlicher Distanz auf jene turbulenten Jahre zurück und greift dann zum glatten Idiom der Erwachsenen, das leider hin und wieder auch in die Sprache der Pubertierenden eindringt. Alles in allem aber ist der Text nachvollziehbar und glaubwürdig. Darin liegt nicht zuletzt sein Wert: Die Lebensnähe und emotionale Dichte laden zur Identifikation ein. Junge LeserInnen werden sich mit Sicherheit in dieser Geschichte finden und dürfen an deren Ende beruhigt feststellen: Auch wenn Gott „ein unendlich trauriger Kerl“ ist, der nur „dabeistehen und zusehen“ kann, wie „das Unvermeidliche“ geschieht (S. 83), können, ja müssen Krisen und Phasen radikaler Orientierungslosigkeit durchwandert werden, um zu mehr Klarheit, Sicherheit und einem neuen Stück Freiheit zu gelangen.
Mit „Im Kokon“ ist Selma Mahlknecht eine ehrliche, realistische und zugleich ermunternde Adoleszenzerzählung gelungen, die nicht nur anregend zu lesen ist, sondern es in sich hat, hilfreich zu sein; also insgesamt ein Buch, das wertvolle Impulse für Gespräche in Klassenzimmern geben kann und dem nicht zuletzt deshalb viele LeserInnen zu wünschen sind.
Herbert Först
Textprobe (das Ende der Erzählung):
„Als ich die Augen aufschlug, war es dunkel, das Gras stach kalt und feucht in meine Haut, und nur schemenhaft konnte ich mein umgestürztes Fahrrad erkennen. Ich rappelte mich hoch. In der Hose klaffte ein Loch, das Blut an den Knien war geronnen. Keiner hatte mir das Leben gerettet. Ich humpelte durch den Wald und hatte in meinem Stolz keine Zeit, mich zu fürchten. Ich lebte und verdankte es keinem, und für einen Moment hätte ich im Übermut mein Shirt zerreißen und die Schuhe ins Moos schleudern mögen, um nackt und schreiend durch die Nacht zu rennen, weil ich befreit war, befreit. Die drückende Last des Kokons war abgestreift.“ (S. 165)
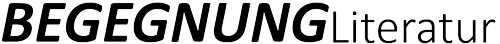
Kommentare sind deaktiviert