„Ich bin mehr als dieser Stein.“
„In Wirklichkeit sagte ich nichts“ – Wolfgang Hermanns mitfühlend analytischer Blick
in die Tiefen des Lebens
Schon 2004, mit „Gesicht in der Tiefe der Stadt“, hatte Wolfgang Hermann Meisterhaftes an Kurzprosa vorgelegt. Was es dort in minimalistischen Skizzen zu entdecken gab, findet sich in der jüngsten Sammlung von Erzählungen mit dem Titel „In Wirklichkeit sagte ich nichts“ wieder: Es ist die hohe Kunst, mit Sprache dem Leben sehr nahe zu kommen, menschliche Erfahrungen in ihrer Tiefe zu treffen. So unterschiedlich die einzelnen Erzählungen in Länge und Erzähltechnik sind, so geschlossen ist ihre thematische Atmosphäre. Wolfgang Hermann nähert sich Menschen, denen das Leben in irgendeiner Form zugesetzt hat, die aber trotz aller Widrigkeit und Schläge – und das macht unter anderem die Kraft dieses Buches aus – diesem Leben verbunden bleiben, sich seinem Geschmack nicht verschließen.
Mit dem ersten Satz der ersten Erzählung – sie ist auch die längste und trägt den Titel „Die tunesische Nacht“ – schlägt der Autor den Ton seiner Sammlung schlicht, aber anschaulich und eindringlich an: „Die Nacht ist ein großer Raum, in dem die Lichter der schlafenden Stadt funkeln.“ (S. 5) Die lakonisch hingesetzte Metapher wird zum Leitmotiv einer Studie, die auf knapp 40 Seiten die Lebenssituation und Stimmung eines Mannes zeichnet, der irgendwo in Europa Marja zurückgelassen hat und nun sich in der nordafrikanischen Stadt einzurichten sucht, neugierig tastend zwar, aber überzeugt: „Ich werde nie wieder zurückkehren. Ja, ich werde nie wieder zurückkehren.“ (S. 21) Verwoben mit diesem Stimmungsbild einer Lebenswende sind eindringliche „Exkurse“ über die sozialen Spannungen in Tunis, über Zustände, die dieses Land zu einem Pulverfass werden lassen: Diese Stadt weist all jene Formen sozialer Zerrissenheit auf, wie sie überall im Süden bestehen und im Norden im Begriff sind sich breit zu machen. Demzufolge zieht sich die Metaphorik der Nacht durch den gesamten Text und schließt diesen mit einer gelungenen Geste der Balance ab, die gleichsam zum Programm des Buches wird: „Ich spüre, wie die Nacht zögert. Schritt für Schritt weicht sie zurück (…) Eine Handbreite noch, und der Tag ist über die Schwelle.“ (S. 39) Das ist Prosa vom Besten, Prosa, die in ihren Bann zieht, weil das Erzählte auf der Ebene der reinen Sprache Gestalt annimmt, und das gibt dem Text Kraft, macht das Lesen zu einer fesselnden Erfahrung.
Von Lebenswenden erzählen auch die anderen Geschichten. Sie alle leben aus einer tief empfundenen Empathie mit Ausgestoßenen, Rechtlosen, Hungrigen, Verzweifelten. Wolfgang Hermanns sozialer Anspruch zeigt sich dabei nicht nur in der Wahl der Schicksale, sondern auch darin, dass die Frage nach dem Warum unbeachtet bleibt: Existentielle Not verbietet die Frage nach den Gründen – so argumentiert der Autor mit seinen Erzählungen.
Wer sind nun einige jener Menschen, denen wir begegnen? In einem Bühnenmonolog, der dem Erzählband den Titel gibt, spricht ein Obdachloser, ein aus dem Leben Gefallener über seine Situation und die Welt, die er „von unten“ beobachtet. Über die Vorgeschichte ist wenig zu erfahren: „Eines Tages ist die Frau fort. Wo die Frau war, bleibt Leere, und in der Leere der Schatten eines anderen Mannes.“ (S. 65) Rätselhaft auch das Auseinanderdriften eines Paares in der Erzählung „Die Treppe“: Für kurze Zeit vermag blankes Mitleid mit dem pflegebedürftigen Mann die Trennung noch zu verhindern, die – so paradox dies klingen mag – mit dem Gesundwerden vollzogen wird. Nicht weniger tragisch die Geschichte jenes Mannes in dem Text „Die Unwirklichkeit“, dem mit dem Tod seines Sohnes das Ich-Bewusstsein abhanden kommt.
So führt uns Wolfgang Hermann von einem „mühselig Beladenen“ zum nächsten, durchwegs Männer, vielleicht um zu unterstreichen, dass „geschlagene Männer“ nicht weniger ihre Fürsprecher brauchen als Frauen.
Das Spektrum der bearbeiteten Themen ist weit: Der Autor philosophiert über schöpferische Prozesse, über die Sprache und das Phänomen Zeit, über die Erfahrungen eines Asylanten, der feststellt, dass „die graue Wand in diesem fremden Land sich in nichts unterschied von der grauen Wand im Keller des Teheraner Evin-Gefängnisses“ (S. 122), und in mehrfachen Variationen über die Kunst eines Lebens im Hier und Jetzt.
„Es wimmelt nur so von Menschengehäusen ohne Füllung. Die wandeln hier Straße rauf und runter, eine Prozession von Hüllen. Ich habe alle Sympathie mit denen. Ich bin ja selbst dann und wann ein Gehäuse ohne Füllung.“ (S. 44)
Diesem „Am-Leben-Vorbeileben“ setzt Wolfgang Hermann die Alternative eines Lebens in Fülle gegenüber:
„Nach den Wochen im Krankenhaus ist nichts mehr, wie es war. Er hat Freude an allem, was er sieht. Er kann sich an den Menschen nicht satt sehen. Nicht satt riechen.“ (S. 91)
Wolfgang Hermanns Prosaband ist ein Glücksfall: Mit diesem Ineinander von brennend aktuellen Themen, erzähltechnischer Vielfalt und unerhört frischer Sprache eröffnet er den Weg zu Leseerfahrungen, die über die magische Kraft der Sprache immer wieder zum Staunen und in die Tiefen des Lebens führen.
Herbert Först
Textprobe:
Der Mann im Park macht seine Arbeit, er betrachtet die Bäume, er betrachtet die Blumenbeete, jedes Jahr sieht er den Stadtgärtnern beim Anlegen der Beete zu, und jeden Herbst, wenn die rauen Stürme kommen, sieht er ihnen zu, wie sie die Blumen schneiden, die Beete winterfest machen. Der Mann im Park ist da, und seinetwegen sterben die Pflanzen nicht. Er wartet darauf, gesehen zu werden. Er hat Zeit. Zeit? Für ihn fließt der Wind dahin, fließen Licht und Schatten ineinander, wechseln Regen und Sonne als Äußerungen ein und desselben Körpers. Er braucht keine Zeit. Zeit ist etwas für die, die ihre Tage unterteilen, die sich verpflichtet haben, eine festgelegte Anzahl von Stunden an diesem und jenem Ort zu sein. Sie verrichten dort Arbeit. Genau wie der Mann im Park. Nur dass seine Arbeit unsichtbar ist. Und doch trägt er den ganzen Park mit all seinen Pflanzen und Bäumen auf seinen Schultern. Den ganzen Park trägt er, und wenn der Wind in die Bäume fährt, dann wird alles leicht. (S. 89)
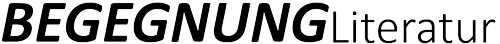
Kommentare sind deaktiviert