„Erzähle mir, was das Leben sein könnte!“
In ihren „Erinnerungen eines Narren“ plädiert Marianne Gruber
für Gewissheit und gegen die Hoffnung.
„Erinnerungen eines Narren“ – Schon der Titel steckt das epische Programm von Marianne Grubers Roman ab: Der Narr, der ungestraft die Wahrheit sagen darf, und die Bilanz am Abend eines Lebens – mit diesen zwei Vorgaben schafft sich die Autorin eine literarische Grundsituation, die der Fabulierlust eines alten Clowns Tür und Tor öffnet.
„Wer? Und weshalb? Ich, das klingt seltsam.“ So beginnt der namenlose Ich-Erzähler seine „Geschichte, die sich an Lächerlichkeit kaum überbieten läßt: ein Clown, der abstürzt“. (S. 5) Seit fünf Monaten ans Bett gebunden erzählt er sie einem konturlosen Besucher, der bloß die Aufgabe des Zuhörens zu erfüllen hat. Ein rasches Ende erwartend muss der Clown erfahren: „Das Leben ist zäh. Ein winziges Ziel genügt, und schon klammert sich alles daran, wie schwach es auch sein mag.“ (S. 10)
Seine Lebensgeschichte setzt am Vorabend des Zweiten Weltkriegs ein und endet – so darf vermutet werden – in den achtziger Jahren. Elf der zwölf Kapitel erzählen von den Kriegsjahren, die der Clown mit einem Zirkus in der Schweiz und Norditalien verbringt. Und das ist erfrischend: die NS-Zeit aus der Außensicht, aus Berichten. Als Bedrohung sind Krieg und Holocaust stets präsent, deren abgründige Grausamkeit ist in der Schweiz aber nur in ihren Ausläufern zu spüren: Über all die Jahre liegt die Gefahr der Abschiebung wie ein nahendes Unwetter in der Luft. Angewiesen auf Duldung erfährt die Zirkustruppe offene Feindseligkeit ebenso wie solidarische Hilfe.
Warum der Ich-Erzähler das Gymnasium in Wien abbricht, ausreißt und mit seiner Kappe sich wie große literarische Vorbilder auf „Wanderschaft“ begibt, wird sowohl mit dem autoritären Gefüge des Jesuiten-Konvikts als auch mit der Atmosphäre zu Hause begründet:
„Kein einziges Buch. Es gab kein einziges, verdammtes Buch zu Hause. Nur leere Flaschen draußen im Rinnsal, Gegröle rundherum, Spott, die schäbigen Häuser, die im schwarzen Morast des Bodens klebten, und Mutters verzweifelte Versuche, in all dem Haltung zu bewahren. (…) Sie weinte oft, aber immer nur allein.“ (S. 67)
Vielleicht ahnt er, was dieser Stadt und seinen Menschen bevorsteht; vielleicht folgt er auch bloß dem geheimen Wunsch sich zu finden. Als er auf den Zirkus trifft, ist er fünfzehn und steht – wie sich bald herausstellt – am Beginn einer kompromisslosen Schule des Lebens. Der Clown Hieronymo und der Zwerg Rollo sind seine Lehrer: der eine mit väterlicher Fürsorge, der andere mit dem Zynismus eines von Geburt an gezeichneten Außenseiters. Hinzu kommt noch die jüdische Trapezkünstlerin Rachel, in die sich der Clown-Schüler verliebt. In ihrer Angst „entdeckt zu werden“ verbringt sie die meiste Zeit in der Kuppel des Zirkuszelts, von der sie schließlich zu Tode stürzt. In dieser Figurenkonstellation trägt der Text durchaus die Züge eines Bildungsromans. Als die Truppe mit Kriegsende auseinander bricht, schlägt sich der nunmehr 22jährige nach Wien durch. Die Suche nach seinem Vater in der zerbombten und ausgehungerten Stadt gehört zu den berührendsten Abschnitten des Buches. Das letzte Kapitel erzählt in massiver Raffung von neuerlichen Engagements als Clown und schließlich von seinem Sturz vom Hochseil, der zur Eingangssituation zurückführt: Ein an den Beinen gelähmter Clown legt seine Lebensbeichte ab.
Diese als durchgehender Monolog gestaltete Geschichte macht aber nur einen Teil des Romans aus. Marianne Gruber reichert sie – im Stile eines Alterswerks – mit einer Gedankenfülle sondergleichen an. Philosophische Exkurse und griechische Mythen fließen ebenso ein wie Tragödien von Shakespeare. Dabei macht sie im Andeuten anderer Handlungsverläufe die Mechanismen gängiger Machtstrukturen sichtbar. Und da ist dann noch ein weiterer Lehrmeister: der rätselhaft-geheimnisvolle Andere, eine Figur, die immer wieder auftaucht. Den Gesetzen von Raum und Zeit nicht unterworfen wandert dieser „stumme Zeuge zerbrechlichen Lebens“ (S. 243) durch die Jahrhunderte und sammelt Berichte über menschliches Leid, um sie für die Überlieferung weiterzugeben.
„Seien Sie nicht überrascht, wenn er völlig unangemeldet auftaucht, das ist so seine Art, er kann den Zeitpunkt nicht bestimmen, der Zeitpunkt wählt ihn, so wie ihn die Geschichten wählen, die er weitergeben soll.“ (S. 314)
In die Lebensbeichte des Clowns legt Marianne Gruber all das, was als Summe eines reichen Lebens gesagt werden kann. Legitimiert als einer, der befugt Weises sagen darf, erörtert der Narr zentrale Fragen des Lebens: Er spricht von der Notwendigkeit, das Altern und den Tod in Bewusstheit und Würde anzunehmen; fragt nach den Möglichkeiten von Liebe und Wärme in einer Welt der Kälte und Zerstörung; betont die fatalen Folgen männlichen Denkens, Fühlens und Handelns; stellt sprachphilosophische Überlegungen an; plädiert für Gewissheit und verwirft die Hoffnung, „dieses Gängelband der Mächtigen“ (S. 296):
„Gebt den Leuten Gewißheit statt Hoffnung, daß nicht der nächste Idiot, der nächste lächerliche Rattenfänger alles, was einigermaßen Zuversicht gestattet, über den Haufen wirft.“ (S. 305)
Existentielle Dunkelheit liegt als Grundtenor über dem Text: „Als Mensch geboren zu werden, bedeutet verloren zu sein.“ (S. 142) Über weite Strecken bestimmen Pessimismus und Verzweiflung über das Los des Menschen den Roman, wofür auch eine metaphysische Erklärung angeboten wird. Zweimal wird – in sprachidenten Aussagen – über Gott spekuliert:
„Gäbe es ihn tatsächlich, wäre er arm dran mit uns. Man müßte ihm wünschen, daß er auf uns vergessen hat, andernfalls würde er nachts im Traum schreien, falls ein Gott schläft und träumt.“ (S. 227)
Dieser Dunkelheit – „Das ist das Leben, ein bißchen Licht, das die Nacht verlöscht.“ (S. 263) – werden Lichtpunkte entgegengesetzt. Sie lassen beim Lesen immer wieder aufatmen, etwa wenn der Clown meint, dass die Welt geschaffen sei, „um erlebt zu werden, nicht um vorhanden zu sein“ (S. 292), oder wenn sein weiser Lehrmeister Hieronymo sagt: „Du hast noch immer das Leben im Blick, und das ist gut so.“ (S. 234).
Marianne Grubers Stil stellt hohe Anforderungen an ihre Leserschaft. Speziell in den handlungsarmen Exkursen greift sie mitunter zu einem Satzbau, der wahrscheinlich jene zum Weglegen des Buches verleitet, die Botschaften zügig und leicht fasslich aufnehmen wollen. Dieser „selektierende Stil“ und Passagen, die sich auch nach mehrmaligem Lesen einer Sinnentnahme entziehen, lassen den Leseakt mitunter mühsam werden und den Gedanken aufkommen, dass weniger Wörter ein Mehr an Ausdruckskraft bedeutet hätten. Eine abschließende Überarbeitung mit diesem Ziel und ein genaueres Lektorat – das Buch weist überraschend viele Fehler auf – hätten dem Roman gutgetan.
Diese Abstriche an Qualität ändern aber nichts daran, dass Marianne Grubers anspruchsvoller, episch ausladender Text reich an Lebensweisheit, erfreulich beunruhigend in seiner Zeitanalyse und als Erzählung über die NS-Zeit erfrischend neu in der Perspektive ist.
Mit ihren „Erinnerungen eines Narren“ hat Marianne Gruber einen gedankenschweren Roman geschrieben, der bewährte literarische Traditionen aufgreift und eigenwillig variiert. Wer anspruchsvolle Lektüre liebt, ist bei dieser Autorin seit ihrem „Tod des Regenpfeifers“ (1991) bestens aufgehoben.
Herbert Först.
Textprobe:
„Am Ende des ersten Tages war ich so müde, daß ich kaum stehen, kaum essen konnte. Der Löwendompteur verhöhnte mich, die Akrobaten, sogar der Liliputaner, den sie Rollo nannten, trieb seine Späße mit mir. Ich stand nur da und dachte nichts. Der Direktor beobachtete mich voll Verachtung, wie mir schien, und in mir nickte etwas. Viertelportion, sagte einer der Jongleure, und ich nickte. Mülltonnengeburt. Ich nickte. Schwächling. Ich nickte, schaute an mir hinunter. Die spindeldürren Beine, die zu langen Arme, meine ungeschickten Bewegungen, kaum Muskeln, keine Kraft. Der Liliputaner hielt mir einen Spiegel entgegen, während er ein Spottlied sang. Ich schloß die Augen, um mich in mir selbst zu verkriechen. Was hatte ich hier bloß gesucht, was erwartet? Der Ungeschickteste und Dümmste von allen hier taugte noch immer mehr als ich. Ich nahm meine Kappe, die letzte Erinnerung an … starrte sie an und wußte nicht mehr, woran mich ihr Geruch erinnerte. An Zuhause? An den Vater, an die Mutter? Zum Geruch des Todes, den ich kannte, war der des Lebens wie ein fernes Versprechen gekommen, zum Schweiß und Geruch der Hinterhöfe der Geruch der Züge und zum Geruch der Züge der Geruch des Landes und des Schweißes der Menschen dort, der Geruch von Fabrikschloten, frisch geschnittenem Gras, von Schnee auf den Bergen, salzigem Wasser, nun vermischt mit dem der Tiere, unter denen ich mich den ganzen langen Tag aufgehalten hatte. An all das erinnerte die Kappe, aber wie von fern, wie an fremde Geschichten, die einer ohne Anteilnahme nacherzählt. Ich roch, ich stank nach ihnen allen, bloß – was war mein Geruch? War man der Geruch der Dinge, der fremden Geschichten, der Abwesenden und der Gegenwärtigen, oder roch so das Fremdsein. War man dadurch fremd, daß sich all diese Gerüche nicht abschütteln ließen, zum Schicksal wurden, ohne je das eigene Schicksal gewesen zu sein?“ (S. 36f.)
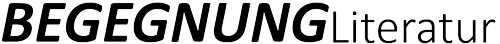
Kommentare sind deaktiviert