Rezension für das Literaturhaus Wien:
„Eine Feuerstelle mitten im Eis“
Daniela Meisels Roman „Der Himmel anderswo“ –
ein Bekenntnis zur Kraft der Zuversicht
„Engel vermuten wir Menschen auf Wolken, Bettler im Staub.“ (S. 7) Mit einem programmatischen Satz eröffnet Daniela Meisel ihren zweiten im Verlag Picus erschienenen Roman „Der Himmel anderswo“. Er erzählt von Menschen, die Schwerelosigkeit suchen, vom Fliegen träumen, aber überall Begrenzung erfahren: „Der Himmel unerreichbar. Von reinem Blau und fremd.“ (S. 7) Von dieser Spannung durchzogen lässt der Roman schon bald die Hoffnung wachsen, das Leben möge zwei jungen Menschen – sie heißen Irina und Milo – irgendwann doch eine heilende Perspektive eröffnen. Dass eine österreichische Autorin dazu tatsächlich den Mut hat, ist selten und tut gut.
Zunächst aber führt der Text in die qualvolle Welt von zwei entwurzelten Kindern. Irinas Vater stirbt an den Folgen eines Grubenunglücks irgendwo im Osten Europas. Von ihrem Onkel wird sie fortan wie in Gefangenschaft gehalten und zum Betteln auf der Straße missbraucht. Nach Jahren demütigender Entbehrungen fällt sie einem Mädchenhändlerring in die Hände. In einer großen Stadt – vermutlich ist es Wien – wartet auf sie das Martyrium der Zwangsprostitution. Durch das Fenster ihrer zellenartigen Unterkunft fällt ihr eines Tages ein junger Mann auf, der in der Astgabel eines mächtigen Ahorns hin und wieder eine Nacht verbringt. Es ist der „Baumschläfer“ Milo. Er hat seine Wurzeln in Bosnien, wo Kriegshorden seine Kindheit zerschlagen haben: sein sanfter Vater massakriert, seine Mutter vergewaltigt. Solcherart entwurzelt begeben sich Mutter und Sohn auf Asylsuche in ein fremdes Land mit all ihren bitteren Erfahrungen. Tage, Jahre vergehen wie „brach liegende Felder entlang der Landstraße“ (S. 63); dann erliegt die Mutter einem Krebsleiden und Milo landet in Wien, wo er mit Hilfe von Menschen, die es gut mit ihm meinen, Arbeit und eine bescheidene Unterkunft findet. Das Leben führt Irina, als sie buchstäblich am Ende ist, mit Milo zusammen. Er, der sich dem Kämpfer Orion verschrieben hat, erkennt ihre bedrohliche Lage; Hals über Kopf verlassen sie das Land, um den Fängen der Zuhälter zu entkommen. Ihr Ziel ist der hohe Norden, ein Observatorium jenseits des Polarkreises. Seit Jahren trägt Milo eine Visitenkarte bei sich, die ihn an die „Einladung in eine fremde Welt“ (S. 94) eines wohlmeinenden Mannes erinnert, in seiner Sternwarte zu arbeiten. Den beiden gelingt die abenteuerliche Flucht. Noch am Abend ihrer Ankunft beobachten sie „gebannt den belebten Himmel“, der hier näher und lebendiger zu sein scheint als je zuvor:
„Ein Meteor schießt über den Himmel und verglüht in dessen Zentrum. Irina lacht leise und Milo spürt, dass sie beide etwas gefunden haben.“ (S. 223)
Das Buch entwickelt einen beachtlichen Sog aus der stetig wachsenden Sorge um die beiden jungen Menschen und aus der umsichtig gebauten äußeren Struktur: In insgesamt 28 Kapiteln wird die Geschichte von etwa zwei Jahrzehnten erzählt. Vom 1. bis zum 18. Kapitel werden Irinas und Milos Leidenswege ineinander verflochten: Die neun ungeraden Kapitel gehören Irina, die neun geraden Milo; das 19. führt die Wege zusammen. In den noch folgenden neun Kapiteln wird es hell für die zwei, obwohl sie der Dunkelheit der Polarnacht entgegengehen.
Die innere Struktur des Romans lebt von einem dichten Netz von Motiven: Schon im ersten Absatz wird Irina eine „Sehnsucht nach Schwerelosigkeit“, der Traum „sich in die Luft zu erheben“ zugeordnet: „Im Alter von sieben Jahren will sie ihre Flügel ausbreiten, nicht ahnend, dass sie die Erfüllung dieses Wunsches auf dem Boden zurücklassen wird.“ (S. 7) Ihr großer Bruder erzählt ihr von „Engeln, die von einem Himmelskörper zum anderen flögen, um deren Lichter zu entzünden“ (S. 14). Fortan begleiten das Mädchen Wortfelder, die von Engeln, Vögeln und Flügeln sprechen, und jenes Kapitel, in dem die beiden aufbrechen und die Großstadt verlassen, beginnt so:
„Irina beobachtet eine Krähe. Sie durchschneidet das Blau, schlägt mit den Flügeln, gleitet mit dem Wind. Ihre Schwingen tragen sie mit beneidenswerter Sicherheit, denkt sie und bewundert ihren kräftigen Schnabel, den Glanz ihres Gefieders.“ (S. 177)
Milo ist – ganz im Sinne seines verstorbenen Vaters – der Erd- und Naturverbundene, der wie Irinas Bruder Oleksander die „schützende Kraft der Baumriesen, die geheimnisvolle Energie der Pflanzen“ (S. 177) sucht, den „Rufen des Käuzchens“ (S. 107) folgt und seine erste Nacht in selbstbestimmter Freiheit in der Geborgenheit des Waldes zubringt. Seines Vaters Liebe zu „winzigen Tieren“ (S. 19) lebt in ihm fort, und dessen gläsernes Prisma, das ihm den „Blick in eine verborgene Welt erlaubt“ (S. 19), trägt er wie einen Glücksbringer an einer Kette um seinen Hals. In der anonymen Betonwüste der Großstadt schläft Milo gelegentlich in der Astgabel eines Ahorns, wo ihn, „den Baumschläfer“, Irina letztlich entdeckt.
Überzeugend auch Daniela Meisels Sprache, an der die oft eindringliche, bildstarke Gestaltung von Sinneswahrnehmungen, körperlichen Empfindungen und Emotionen beeindruckt:
„Auf der Erde liegend fühlt er, wie die Dunkelheit des Gewölbes in seine Mundhöhle kriecht. Sie bewegt sich seinen Rachen, die Luftröhre hinab in seinen Brustraum, breitet sich in seinen Lungenflügeln aus, verdrängt den Sauerstoff und bringt Kälte. Der Raum wird enger. Die Decke sinkt. Wände und Boden rücken näher an seinen Körper heran.“ (S. 10)
„Irina hat das Gefühl, in regelmäßigen Abständen zu wachsen und wieder zu schrumpfen. Noch vor Minuten war sie überzeugt, entkommen zu sein. Für immer. Davor war die Angst eine riesige, über sie gestülpte Kuppel. Schwarz gefärbtes Glas. Lichtlos.“ (S. 189)
Elliptisch derart verknappte, rhythmische Verdichtungen sind häufig, geben dem Stil Kraft und Intensität, machen Unsichtbares erlebbar. Nur selten geht dabei das Maß verloren, wäre ein Mehr an Ökonomie wünschenswert.
Thematisch stellt sich der Roman brennenden Fragen unserer Zeit: Irinas und Milos Erfahrungen geben Einblick in die Qualen von Asylsuche, erwerbsmäßigem Betteln von Kindern, Menschenhandel, sexuellem Missbrauch und Zwangsprostitution.
Titel, erster Absatz und letzter Satz erweisen sich als Verweise auf das zentrale Thema: die Suche nach einem Himmel irgendwo. Dass Milo und Irina ihrer Hölle entkommen und sich ihnen letztlich eine menschenwürdige Perspektive eröffnet, hat tiefliegende Gründe: Beide leben im Bewusstsein ihrer starken Wurzeln, haben sich trotz widrigster Umstände eine wesenhafte Verbundenheit mit der Natur bewahrt und gehen mit seltener Behutsamkeit aufeinander zu. Die Hoffnung, dass ihrer beider Verletzungen im hohen Norden heilen werden, erinnert an Melitta Brezniks Roman „Nordlicht“, in dem auch – so paradox es klingen mag – in der Finsternis der Polarnacht eine hellere Zukunft anbricht.
So hat der auktorial solid erzählte Roman einiges zu bieten: Er führt vor Augen, wie in Europa mit Opfern wirtschaftlich und sozial zerbrochener Gesellschaften verfahren wird; er vermag Mitgefühl auszulösen und Verantwortung wachzurufen; und er stellt das sich immer schneller drehende Leben in Ballungsräumen in Frage:
„Der Bahnhof ist eine Baustelle. Löcher klaffen in Mauern, der Himmel lugt durch aufgerissene Decken und Bagger graben ihre zahnbesetzten Schaufeln gefräßig in das Erdreich. Kräne ohne Fracht drehen sich ziellos um ihre eigene Achse, sodass ihre Fahrerhäuschen im Wind schwingen, als bewegten sie sich zu einer für Menschen unhörbaren Melodie.“ (S. 125)
„Die Häuserblocks ähneln einander, stehen in Reih und Glied wie überdimensionale Betonsoldaten, nur auf ein Kommando wartend, über die Menschen zu ihren Füßen hinwegtrampeln zu können, und bald hat er das Gefühl, ein Labyrinth aus Mauern, Straßen und Gassen zu durchwandern, in dem hinter jeder Ecke Gefahr lauert.“ (S. 126)
Diesem verwirrend verworrenen Leben stellt die Meeresbiologin Daniela Meisel die Natur als bergenden Boden eines menschenwürdigen Lebens gegenüber, heute mehr denn je Vision als reale Existenzmöglichkeit.
„Müde lässt er sich nach einiger Zeit in einer Kuhle nieder. (…) Sie ist durch Strauchwerk und Wurzeln vor Regen und Wind geschützt und er polstert sie mit Farnwedeln und legt sich darauf. In einer seitlichen Position zieht er Arme und Beine an sich, um möglichst wenig Körperwärme an die Umgebung zu verlieren. Als Embryo in einer Vertiefung auf dem Waldboden liegend lässt er den Geruch der Erde, der Losung der Tiere, von Kräutern, Pilzen, Nadeln, welkem und zersetztem Laub in seine Nase strömen. Er atmet den Duft des Werdens und Vergehens …“ (S. 109)
„Der Himmel anderswo“ – ein lebensbejahendes Buch in einer Zeit, in der Meldungen über Gewalt, Gier und Ausbeutung uns bisweilen den Atem nehmen. Daniela Meisel Text weiß von einem Dennoch:
„Trotz des Hohlraums, den der Tod seines Vaters und seines Bruders ihm in den Brustkorb gegraben haben, beschließt das Mädchen zu leben.“ (S. 24)
Von dieser Kraft der Zuversicht lebt ihr Roman.
Textprobe:
„Zuerst will ich das Meer sehen“, erklärt Irina und der Klang ihrer Stimme scheint Milo verändert, selbstsicher und bestimmt. Er willigt ein. Rasch läuft sie voraus, folgt der Beschilderung, die den Weg zum Strand weist, sodass er Mühe hat, ihr zu folgen. Seine Muskeln sind vom langen Sitzen verkrampft und seine Beine steif. Irina läuft eine Düne hinauf, zieht oben angekommen Turnschuhe und Socken von den Füßen und wirft beides von sich. Sie läuft hinunter, breitet die Arme aus, legt den Kopf in den Nacken und schreit einen Jubelruf, der Milo an das befreite Trällern eines eben aus seinem Käfig entschlüpften Vogels denken lässt. Sie wirft sich zu Boden, rollt die letzten Meter, bleibt am ebenen Strand sitzen, spuckt prustend Sandkörner und Steinchen, und er lacht wie schon lange nicht.
Danach sammelt sie Muscheln, Schneckenhäuser, die harten Überreste von Tintenfischen, läuft knietief in die Wellen, benetzt ihr Gesicht mit dem Salzwasser, leckt ihre Lippen, spuckt aus, als fühlte sie zum ersten Mal seit vielen Jahren das Leben. Milo versucht nicht, sie zurückzuhalten, drängt nicht, ein Schiff zu finden, das sie über das Meer bringen soll, beobachtet sie nur, weil er das Gefühl hat, ihr Verhalten tue ihr gut. Irina türmt das gesammelte Strandgut zu einem Haufen, setzt sich darauf, und die Gehäuse der Schalentiere brechen unter ihrem Gewicht. Milo hört das Splittern der kalkigen Gebilde, sieht Irina still weinen und es scheint ihm, als wären es gute Tränen. Sie hockt sich neben die Bruchstücke und ruft ihn zu sich.
Barfuß sitzen sie an der oberen Wasserlinie. Nur die Ausläufer der höchsten Wellen umspülen ihre Zehen, deren Haut sich bald rötet, und sie sehen auf das Meer hinaus, dessen Oberfläche das Grau des bedeckten Himmels reflektiert. Möwen schaukeln weit draußen zwischen den Schaumkronen, sind helle Punkte auf dunklerem Grund, und Milo schließt die Augen, fühlt die reinigende Kälte, die Kraft von Wellen, Wasser und Wind. (S. 198f.)
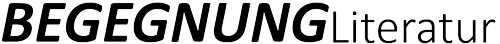

Kommentare sind deaktiviert