Eine Veranstaltung im Rahmen von art.experience 2017
8. November 2017, Arnulf Rainer Museum
„Was will ich eigentlich?“ (S.56)
In ihrem neuen Roman „erbsenzählen“ erzählt Gertraud Klemm von einer jungen Frau, die „nur Leerstellen“ statt „Erbsen auf den Tisch legen kann“.
„Wenn einer in sein dreißigstes Jahr geht, wird man nicht aufhören, ihn jung zu nennen. Er selber aber, obgleich er keine Veränderungen an sich entdecken kann, wird unsicher; ihm ist, als stünde es ihm nicht mehr zu, sich für jung auszugeben.“ (Ingeborg Bachmann: „Das dreißigste Jahr“)
Das dreißigste Jahr – Lebenszäsur in vielen literarischen Texten, vornehmlich in Entwicklungs- und Bildungsromanen. Die Ich-Erzählerin in Gertraud Klemms jüngstem Roman steht auch an dieser Schwelle, von der Ingeborg Bachmann sagt:
„Er wirft das Netz Erinnerung aus, wirft es über sich und zieht sich selbst, Erbeuter und Beute in einem, über die Ortsschwelle, über die Zeitschwelle, um zu sehen, wer er war und wer er geworden ist.“
Es wird lohnend sein, sich dem Text „erbsenzählen“ auch unter diesem Aspekt zu nähern. –
Gertraud Klemms Blick auf die Welt ist weiblich, mehr noch: Er ist konsequent feministisch. Nach „Herzmilch“ und „Aberland“ geht auch ihr dritter Roman der Frage nach weiblichen Lebensentwürfen, deren Umsetzung und Konsequenzen nach. „erbsenzählen“ – das ist ein Ausloten des schmalen Grats zwischen Freiheit und Bindung, dem sich Frauen, die nicht gelebt, nicht fremdbestimmt werden wollen, ausgesetzt sehen. Um diese Frage zu diskutieren führt Gertraud Klemm eine knapp 30jährige Frau in eine Beziehung mit einem doppelt so alten Mann.
Wer ist diese Frau? Sie heißt Annika, hat ihre Arbeit als Physiotherapeutin aufgegeben und verdient sich ihren Lebensunterhalt als Kellnerin im Café „Namenlos“ in Wien. Keine ihrer bisherigen Beziehungen zu Männern hat zu einer Bindung im herkömmlichen Sinn geführt. Sie ist Single, entscheidungsschwach, aber stets darauf bedacht, ihre Freiheit nicht aufs Spiel zu setzen. Da tritt Alfred in ihr Leben. Er ist ein intellektuell versierter Endfünfziger, ein erfolgreicher Kulturredakteur mit „Waldhonigstimme“ (S.13) und erfahrener Liebhaber, geschieden, Vater eines dreizehnjährigen Jungen namens Elias. Annika und Alfred verbringen ihre gemeinsame Zeit – vornehmlich an Wochenenden – im Weinviertel, genießen dort die Sonnenseiten einer Beziehung:
„Ich sollte mich dafür bedanken, dass Alfred mich trainiert, mich lebendig zu fühlen. Jeder von uns hält ein Ende des zarten Bandes der Leidenschaft in der Hand, ganz freiwillig, ohne Ehe, Kind oder Einfamilienhaus.“ (S.21)
Doch die „Patchworkpflichten“ (S.7) lassen nicht lange auf sich warten. Schon im Eröffnungskapitel erlebt Annika sich in der Rolle der „Stieftussi“ (S.5), die Elias zum wöchentlichen Fußballmatch begleitet.
„Vor der Garderobe schlagartig Turnsaalgeruch, nicht überraschend, aber in dieser Heftigkeit dann doch, ein Bubengeruch, noch nicht beißend, aber schon eine Spur Raubtier.“ (S.5)
„Schlagartig“ auch der Erzähleinstieg: Mit dem ersten Satz begibt sich der Text in das Bewusstsein der Ich-Erzählerin Annika, die auf 160 Seiten – der Fahrt auf einer Hochschaubahn ähnlich – erkundet, was Alfreds Einstieg in ihr Leben für sie bedeutet. In der Folge entsteht ein farbenkräftiges Mosaik, dessen einzelne Steine Annikas Bekannte, Freunde, Familie und Arbeitssituation ins Licht rücken und die Gefühls- und Gedankenwelt der Ich-Erzählerin lebendig werden lassen. Die erlebt sich vor allem als Suchende: Wo ist mein Platz in Alfreds Leben? Was ist meine Bestimmung als Frau?
Als Alfred einen „leichten Vorderwandinfarkt“ (S. 90) erleidet, muss Annika irritiert mitansehen, wie seine geschiedene Frau Valerie als „Vertraute“ wieder auf den Plan tritt. Da wird ihr klar, dass sie für ihren Anspruch auf Freiheit bezahlen muss:
„Es geht mich nichts an, ob Alfred Valerie noch liebt oder wieder. (…) Ich habe den Fehler gemacht, mich sogar in seinen Tod einmischen zu wollen. Alfred hat nur seine Familie zu beschützen versucht. Die Mauer, die er errichtet hat, gilt nicht mir im Speziellen. Sie verläuft um ihn und seine Kernfamilie, so selbstverständlich wie ein Gartenzaun um ein Einfamilienhaus. (…) Mein Platz war außerhalb des Hauses, außerhalb des Gartens, in einer anderen Stadt. Auch ich habe Alfred auf Distanz gehalten.“ (S.149)
Mit dieser Einsicht muss Annika akzeptieren, dass sie bloß eine Episode in Alfreds Leben gewesen ist.
Folgerichtig symmetrisch der Aufbau: Annikas Eintritt in Alfreds Patchworkfamilie im ersten Kapitel entspricht ihr Rückzug im letzten; im Zentrum jene beiden Szenen, die schon früh ahnen lassen, dass die Beziehung nicht dauerhaft sein wird: Sowohl Alfred als auch Annika scheuen davor zurück, in der Öffentlichkeit zueinanderzustehen. –
Bloß Episode gewesen zu sein, das schmerzt. Dieser Schmerz kommt aber nicht überraschend: Auffallend oft bricht Annika in Tränen aus oder unterdrückt ihre Tränen; es sind Tränen darüber, dass sie in ihrer Kindheit eine „herzlose Erbsenzählerin“ (S.53) zur Mutter hatte und nicht jene Liebe erfuhr, die sie – rückblickend – gebraucht hätte; dass sie ihre Entscheidung für Freiheit mit dem Verzicht auf eine „verbindliche Zweisamkeit“ (S.79) in der Geborgenheit einer Familie bezahlen muss; dass sie ihre sexuellen Begegnungen mit Männern mitunter demütigend erlebt; und auch darüber, dass ihre Ernte beim „Erbsenzählen“ ernüchternd ausfällt.
Mit dem Titel „erbsenzählen“ umkreist Gertraud Klemm ein zentrales Thema ihres Romans: Annika lebt in einer Welt, in der jeder und jede darauf aus ist, möglichst viele Erbsen einzufahren – Erbsenzählen als Metapher für das kapitalistische System des Anhäufens, und das auch im Bereich sexueller Beziehungen:
„Seit ich Mitte zwanzig bin, habe ich das Gefühl, dass die Beziehungen in meiner Umgebung zu profanen Werkzeugen des Kapitalismus verkommen sind.“ (S.14)
Wer anhäuft, ist erfolgreich, angesehen, bestimmt, wohin die Kugel rollt; und „alles wird auf Facebook gepostet und beim zehnjährigen Maturatreffen auf den Tisch gekippt.“ (S.14)
Es wäre kein Text von Gertraud Klemm, wenn der Lebensstil unserer Zeit nicht ordentlich gegen den Strich gekämmt würde, und das tut sie mit viel, sehr viel Ironie. Treffsicher fallen die Schläge aus: Ob Tendenzen in der Kindererziehung, im Gesundheitssystem und Kulturbetrieb – Annika erzählt nicht nur ihre Geschichte, sie lässt uns auch teilhaben an ihren zeitkritischen Beobachtungen.
Gekonnt auch die Erzählkunst: Schon auf den ersten Seiten entwickelt der Roman einen Sog. Der ergibt sich nicht nur aus dem Plot und den zahlreichen scharfen Analysen, sondern vor allem aus der Erzählperspektive, die eine Sprache nach sich zieht, die – lebendig, unbekümmert und metaphernreich – als authentische Stimme Annikas überzeugt.
Konsequent im Bewusstsein der Ich-Erzählerin angesiedelt, öffnet die Erzählperspektive reizvolle Türen: Erinnerungsartige Rückblenden geben Einblick in Annikas Kindheit und Jugend, werfen im „dreißigsten Lebensjahr“ das „Fangnetz der Erinnerung“ aus, in dem Annika sich fragt, wie sie so geworden ist, wie sie ist:
„Ich blicke auf die Silbertanne, die gewachsen ist, und ich bin auch noch da, in allen Entwicklungsstufen, ineinandergeschachtelt wie eine Matrjoschka liegen wir alle in meinem Jugendbett, und gestern und heute ist eine weitere Schicht hinzugekommen, die sich dünn anfühlt, unbemalt, unlackiert.“ (S. 139)
Annikas emotionale Berg- und Talfahrt, die in einem LSD-Trip kulminiert, führt die Zerrissenheit einer jungen Frau vor Augen, die vor der entscheidenden Frage steht, „angeschraubt im Leben eines Mannes“ (S.79) zu sein oder kategorisch an der „wunderbaren Freiheit“ festzuhalten, die aber „immer Hand in Hand daherkommt mit ihrer anhänglichen Schwester, der Einsamkeit“ (S.102). Und auch die Frage der Mutterschaft geht Annika, die eine Abtreibung hinter sich hat, immer wieder durch den Kopf:
„Vielleicht wäre ein Baby doch keine schlechte Idee. So ein Baby ist der perfekte Neubeginn, ein Baby wäre eine Brandrodung für mein verpatztes Leben, ein Neustart.“ (S.136)
Im Verlauf des Romans gelangt Annika schließlich an jenen Punkt, von dem es im Motto heißt: „There is a princess in all our heads: she must be destroyed.“ (S.4); sie verabschiedet sich von der „Auserwählungsfantasie aus der Prinzessinnenkiste“ (S.142), kurz: von ihrer Sehnsucht, „diejenige“ zu sein.
Dass sie in ihrem „dreißigsten Jahr“ die karge Bilanz ihres bisherigen Lebens und das Ende ihrer Episode mit Alfred in „stiller Größe“ akzeptiert, liegt wesentlich daran, dass sie selbstkritisch genug ist, sich ihre eigenen Anteile an ihrem „verpatzten Leben“ einzugestehen: „Mitleid kann ich keins erwarten.“ (S.153)
Solcherart erfahren wird Annika die Schwelle des dreißigsten Jahres hinter sich lassen. Der Text legt diese Vermutung nahe: Während im ersten Satz des Romans ihre Perspektive auf die Tür einer Bubengarderobe verengt ist, öffnet sich im letzten Absatz ihr Ausblick vielversprechend: „Im Nachmittagslicht hatte der Schneeberg begonnen zu leuchten.“ (S.160) Als Annika beobachtet, wie Alfred auf der Terrasse des Looshauses im südlichen Niederösterreich sich mit „seiner weichen, einlullenden Stimme“ (S.159) an eine jüngere Ausgabe von Valerie heranmacht, lässt sie ihn einfach zurück und setzt sich in Bewegung:
„Ich blieb stehen, um sie nicht zu stören, sie bemerkten mich gar nicht, sie waren so vertieft ineinander, dass sie meine Schritte nicht hörten, die plötzlich innehielten und sich nach einer Weile entfernten. (…) Der Taxifahrer (…) öffnete mir höflich die Tür, als wäre ich ein neuer Fahrgast.“ (S.159)
Diese behutsam gearbeitete Schlussgeste spricht dafür, dass Annika ihren Weg finden wird. Sie hat sich mit weiblichen Lebensentwürfen auseinandergesetzt und für sich erkannt, dass feministische Selbstfindung nur unter einer Voraussetzung möglich ist: „The princess in my head must be destroyed.“ So gelesen kann „erbsenzählen“ Orientierungshilfe für Frauen sein und Männern Einblick geben in die existentielle Entscheidung zwischen Mutterschaft, Familie und Selbstbestimmung, vor die Frauen seit Jahrhunderten gestellt sind. Darin liegt – abgesehen vom Reiz der Lektüre – der Wert dieses Buches.
Herbert Först
TEXTPROBE:
Mein Krankenhausbesuch war nachmittags, ich hatte zwei Stunden bei Alfred eingeplant, nach dreißig Minuten wussten wir schon nicht mehr, was wir reden sollten. Wie fragil der menschliche Körper ist, so eine kleine Ader und so ein Riesentheater, und gleich so nahe am Tod. Da ging die Tür auf und Valerie kam herein, in einem edlen, schwarzen Wollmantel, der so sehr Alfreds Geschmack entspricht, dass ich augenblicklich wusste, Alfred hat ihn ihr gekauft. Er sah neu aus, ganz flauschig und weich, ich hätte ihn gerne berührt. Sie rauschte auf Alfreds Bett zu, der Duft nach Pfirsichshampoo hüllte uns alle drei ein. Sie war aufgebracht, besorgt, sie begrüßte mich nur mit einem angedeuteten Lächeln. Was der Arzt gesagt hätte. Wie dieser Wert und jener Wert aktuell stünden. Sie war viel besser informiert als ich, und Alfred ließ sich wieder ein bisschen in sein Kissen, in sein Leid zurücksinken, er suhlte sich in der Fürsorglichkeit, auf die er scheinbar gewartet hatte. Valerie exerzierte mir vor, wie das geht, das da sein. Man soll nicht einfach dasitzen und präsent sein, man muss empathisch sein, hineinkriechen in den anderen. Ich fürchte, das habe ich nie gelernt. Valerie und Alfred können das, sie sind eine Familie. Elies hat sie zur Familie gemacht, er hat sie so zusammengeschweißt, dass keine Scheidung, kein Vergehen, keine Verfehlung die beiden auseinander bringen kann. Nicht Alfreds zerstreuter Egoismus, seine Gedankenlosigkeiten, seine schwierigen Dienstpläne, nicht die Sache mit der Erbschaft, die er gemacht hat und in das Wochenendhaus investierte statt in eine größere Wohnung in Wien, und die Valerie offiziell als Scheidungsgrund artikuliert hat, nichts, was in der Zukunft passieren wird. Elias ist ihre gemeinsame Zukunft. Valerie berührte Alfred an der Schläfe, um eine Staubfluse zu entfernen, genau dort, wo ich ihn selbst so gerne berühre. Kein Haar passte zwischen die beiden, und schon gar keine Annika. Eine Welle der Enttäuschung brach über mich herein, ein zäher Strudel im Magen, etwas wurde abgesaugt, mir wurde flau. Ich stand auf, sie sahen mich jetzt beide an, erschrocken, aber verschworen, ich musste mich schnell verabschieden, Valerie drückte mir ihre samtige Wange auf, erst rechts, dann links, diese affige Begrüßungs- und Abschiedsküsserei, wie ich sie hasse. Ich muss, sagte ich, ohne Angabe von Gründen, so ist es am besten, dann küsste ich Alfred auf den Mund, vorsichtig und demonstrativ. (S.93ff.)
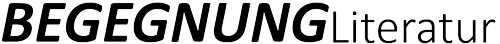
Kommentare sind deaktiviert