„Vogelschau und Lebensfaden“
In „Über Nacht“ geht Marianne Gruber auf die Suche
nach einem „Leben mit mehr Bestand“.
In ihrem jüngsten Roman knüpft Sabine Gruber ihre Studien über die Zerbrechlichkeit des Lebens weiter, und wie schon in früheren Texten legt sie den Fokus auf Erfahrungsberichte von Frauen: diesmal auf jene von Irma in Wien und Mira in Rom. Zerbrechlich und hinfällig ist vieles in ihrem Leben, und das nährt ihre Sehnsucht nach all dem, was ihnen abhanden gekommen ist, sie entbehren müssen und erwarten. Denn eines ist beiden bewusst: „Es würde auf den Inhalt, nicht auf die Dauer des Lebens ankommen.“ (S. 53)
Die beiden Geschichten sind rasch erzählt. Als Dialysepatientin hat Irma, die Brücken liebt (S. 52), über viele Jahre die Hinfälligkeit ihres Körpers als Kerker erlebt. „Über Nacht“ hat eine Nierentransplantation sie von dieser Abhängigkeit befreit. Noch im grenzenlosen Staunen über die überraschende „Entgrenzung“ ihres Lebens gefangen, wird sie den Gedanken nicht los, dass irgendeines Menschen Tod ihr dieses neue Leben geschenkt hat. Die Suche nach dem Vater ihres Sohnes Florian führt die alleinerziehende Mutter nach Rom, wo Mira als Altenpflegerin arbeitet. Dieser ist Vittorio fremd geworden, so fremd, dass sie detektivisch in Erfahrung bringen möchte, was Vittorio von ihr wegtreiben lässt. Bald schon vermutet sie homosexuelle Bindungen. In ihrer Irritation und Enttäuschung gibt sie dem dreisten Werben Rinos nach, der – er ist der von Irma gesuchte Vater Florians – den Kreis nach Wien schließt.
Schritt für Schritt fügen sich die einzelnen Mosaiksteine zu zwei Bildern von Frauen unserer Zeit zusammen: Die ungeraden Kapitel erzählen von Mira, die geraden von Irma. Diese Struktur lässt Spannung entstehen: Schon nach wenigen Seiten treibt vor allem eine Frage die Lektüre an: Was mag die beiden Frauen verbinden? Strukturell einer Fuge ähnlich bewegen sich die beiden Handlungsstränge auf eine Klärung zu, die auf der letzten Seite in einer gelungenen Pointe den/die Leser(in) überrascht: Mira, die aus dem Anagramm der Buchstaben „I-R-M-A“ geschaffene Frau aus Rom, entpuppt sich als fiktive Figur in einer Geschichte, die in Irmas Kopf gesponnen wird und in einem Autounfall endet: Miras Tod hat Irma ein zweites Lebens geschenkt – „Mira“, das Wunder in Irmas Leben.
„Irma stand auf, stützte sich an der Lehne ab. Auf Stirn und Nase waren kleine Schweißtropfen. Ich will wissen, warum ich lebe, dachte sie.“ (S. 166)
In diese gekonnt geknüpfte Geschichte legt Sabine Gruber eine Fülle von geistreichen Notizen ihrer Heldin Irma über das Leben und eine Handvoll gesellschaftspolitisch brisanter Themen, die sich fast allesamt dem Begriff „Zerbrechlichkeit des Lebens“ zuordnen lassen.
„Als sich die Hände wieder beruhigt hatten, ging sie zurück in ihr Badezimmer, drückte den Hebel für die flüssige Seife, einmal, zweimal. Sie betrachtete sich im Spiegel und vergaß, was sie gerade tat. Drückte. Schaute. Wohin ich auch gehe, ich komme über meinen Körper nicht hinaus.“ (S. 42)
Zusätzlich zur Hinfälligkeit ihres Körpers wird Irma mit der kompliziert sich darstellenden Homosexualität ihres Bruders konfrontiert, wobei es der Autorin offensichtlich darauf ankommt zu zeigen, dass die konkrete Akzeptanz gleichgeschlechtlicher Partnerschaften noch in weiter Ferne liegt. Irma selbst hat in ihren Beziehungen noch keinen festen Boden betreten, und auf brüchiges Terrain führt sie auch ihre Arbeit: Sie verfasst eine Serie über verschwindende Berufe. Eine ihrer Recherchen eröffnet ihr – und darin liegt ein wohltuendes Gegengewicht in diesem Text – eine neue Beziehung, die ihr viel von dem verspricht, was sie bisher nicht gefunden hat.
„Sie sah ihn an, erstaunt, küßte seine Fingerspitzen, war froh, daß er da war, gleichzeitig glaubte sie, einen Fehler begangen, zu schnell nachgegeben zu haben. Sie wollte endlich etwas Festes, etwas, das dauert. Ein Leben mit mehr Bestand, hatte Irma letzte Nacht in ihr Notizbuch geschrieben, keine Tage, die vor einem umfallen, keine Stunden, die zittern. Ihr war das Wort Gleichmut eingefallen.“ (S. 148)
In seinem innersten Kern aber ist der Roman eine Auseinandersetzung mit den Rätseln in unserem Leben, ein Einsteigen auf Fragen, die zu keinen Antworten führen können.
„Was ist schon individuell, dachte Irma. Wir sind in dieses große Ganze eingebunden und können uns kaum rühren. Florian ist ebenso ungeplant entstanden, wie mein Spender möglicherweise unvorhergesehen gestorben ist. Wir werden durch glückliche oder unglückliche Fügungen geboren, und manchmal ist es sogar der Zufall, der uns auslöscht. Er korrigiert seine Fehler nicht.“ (S. 22)
Erst mit dem Ende des Buches werden Irmas Gedanken zu einer versteckten Vorausdeutung. Kunstgriffe dieser Art lassen den Roman zu einer anregenden Reise durch zart eingewobene Verweise werden.
Es liegt in der Erzählstruktur begründet, dass Irmas Lebenswelt sich in der fiktiven Geschichte von Mira spiegelt: auch dort die Problematik homosexueller Bindungen, auch dort die Frage nach der Liebesfähigkeit des Mannes.
Dass Sabine Gruber sich auskennt, wenn es um die unbefriedigende Situation alter, pflegebedürftiger Menschen oder um die Wahrnehmungen des Körpers geht, ist auf Schritt und Tritt zu spüren, und zwar so authentisch, dass es einem nicht schwer fällt, die körperlichen Gebrechen und Höhen der Figuren mitzuerleben.
Wie stark Irmas Wunsch ist, über jene Person etwas zu erfahren, deren Niere sie in sich trägt – bezeichnenderweise verbindet die östliche Medizin die Niere mit dem Sitz der Lebensenergie -, verrät die Erzählperspektive: Während ihre Geschichte personal erzählt wird, ist ihre Identifikation mit der fiktiven Spenderin Mira offensichtlich so stark und lebendig, ist sie Mira so nah, dass diese zur Ich-Erzählerin wird: Schöpferin und Geschöpf werden sozusagen eins.
„In der linken Leistengegend stach es; deswegen strich sich Irma mehrmals mit der Hand über den kleinen Hügel, unter dem sich das Transplantat befand. Sie blickte nach dem Diktaphon, konnte es aber nirgends entdecken, also memorierte sie den Satz, der ihr gerade eingefallen war, so lange, bis sie Papier und Bleistift zur Hand hatte. Wie nehme ich mich heraus aus diesem anderen Leben, das doch in mich hineingepflanzt worden ist? Irma war es unheimlich, daß es in ihr dachte, ohne daß sie selbst entscheiden konnte, was sie nun denken wollte und was nicht.“ (S. 145)
Einen besonderen Reiz bekommt der Text von seiner starken Spannung zwischen schlichtem, unprätentiösem Stil und einem eindringlichen poetischen Geflecht aus zwei Motivkreisen: Während Miras Geschichte leitmotivisch von Vögeln, Staren und Tauben im Besonderen, durchsetzt ist, erhält Irmas Text in rhythmischen Abständen seine Kraft aus Wüsten-, Dünen- und Sandbildern.
„Irma träumte, die Erde sei eine Scheibe; vor ihr läge eine Steinwüste, die sich nach und nach in eine Sandwüste verwandelte. Sie sah sich auf den Rand zulaufen; der feine Sand fiel in einer gewaltigen Staubwolke über die Kante ins Nichts hinab; rundherum blinkte grelles Licht, als träfen mehrere Sonnen auf Glas. Die Staubkörner drangen in ihre Kehle. Irma hechelte. Als sie schweißgebadet aufwachte, fiel ihr das Wort Sanduhr ein.“ (S. 151)
„Irma stand wieder auf, ging rüber zu dem Buch mit den Staren. Anfangs, erinnerte sie sich, waren es noch einzelne Punkte gewesen. Dann plötzlich hunderte, tausende. Sie bewegten sich rauf und runter, hin und her, stürmisch, kraftbeladen.“ (S. 238)
In dieser Spannung von Kargheit und Freiheit erreicht der Roman immer wieder zeitlose Schönheit und Tiefe. Ganz im Einklang mit der Struktur dringen die Stare mit dem Fortgang der Geschichte in Irmas heller werdende Welt ein und führen zurück zu Miras Erzähleinstieg. Dieses Zurück zum Anfang klärt nun auch alles auf: Irma schreibt Miras Geschichte. Warum? Vielleicht als Dank an jene Frau, die ihr ein neues Leben geschenkt hat, denn mit dieser Geschichte schafft sie mehr als bloß ein Dokument der Verbundenheit: „Ich werde mir meine Tote erfinden. Ich muß ihr das Leben zurückgeben.“ (S. 238) Damit geht sie zurück zum Ursprung aller Literatur: zur Überwindung des Todes durch das Erzählen von Geschichten.
Bleibt nur noch zu sagen, dass Sabine Gruber mit „Über Nacht“ ein Roman geglückt ist, für den man/frau dankbar sein muss.
Herbert Först
Textprobe:
Am Himmel flogen wieder Stare; sie zogen langsam, gedrängt; der schwarze Haufen bewegte sich über den Gran Raccordo Anulare . Was ist, warum lösen sie sich nicht auf, dachte ich, warum formieren sie nicht neue Verbände? Die Anführer werden doch viel zu sehr beansprucht. Ich schaltete das Radio ein, suchte einen Sender, drückte die CD-Taste. Es steckte keine Disk im Schlitz. Immer wieder richtete ich meinen Blick auf den hellen Himmel. Ich wartete darauf, daß sich die dunkle Wolke lichtete, aber die Stare flogen weiterhin eng zusammengepfercht, als wäre dort oben zuwenig Raum.
Ich beugte mich vor, langte nach dem Handschuhfach. Da war nur Papier, eine Zigarettenschachtel, etwas, das sich nach einem Taschentuch anfühlte. Wo hat Vittorio die CDs hingegeben. Ich bückte mich, suchte unter dem Beifahrersessel, tastete nach einer leeren Cola-Dose. Der Song Every man has a man who loves him fiel mir wieder ein. Ich richtete mich auf, schlug mit der Hand auf das Lenkrad. Eine der Brandblasen platzte auf; ich bemerkte es erst, als ich mit derselben Hand über die Stirn strich.
Ich sah auf die Straße, der Verkehr hatte etwas nachgelassen.
Das Auto vibrierte, weil ein Lastwagen vorbeirollte. Wieder schaute ich in den Himmel.
Ich muß noch Mutter anrufen. Sie weiß gar nicht, daß ich komme.
Da – endlich scherten ein paar Vögel aus, ich erkannte die fernen Punkte. Meine Hand war noch immer unter dem Sessel, erwischte endlich eine Hülle, klappte sie auf – sie war leer. Immer mehr Stare flogen nun versetzt vor den anderen, bildeten nach und nach eine Linie. Jemand hupte. Ich erschrak, war zu weit links. Riß am Lenkrad. Ein Quietschen, ein Knall – (S. 229f.)
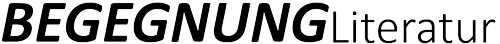
Kommentare sind deaktiviert