Von der „Lüge der Erkennbarkeit der Welt“
„Die Insel im Maismeer“ – Friederike Schwabs philosophierende Suche nach Identität
Wie in so manch anderem Text ist es auch im Roman „Die Insel im Maismeer“ der Tod der Mutter, der einen weitreichenden und tiefgehenden Prozess der Selbstprüfung und -findung auslöst. Mit der Einstiegsszene legt sich die aus Graz stammende Autorin einen erzähltechnischen Kunstgriff zurecht, der ihr fortan die Möglichkeit gibt, die Ich-Erzählerin immer wieder in einen Dialog mit ihrer inneren Stimme treten zu lassen. An einem „außergewöhnlich schönen, warmen Tag“ vernimmt das etwa vierjährige Mädchen erstmals diese Stimme. Im Garten des Großvaters macht das Kind eine existentielle Erfahrung:
„Ich erinnere mich: Es war ein Moment totalen Unglücks gewesen. Perfekt und eindringlich, auf bestechend klare Weise. Denn ich kannte den Grund für mein Unglücklichsein nicht. (…) Und ich stand einfach so da. Das war alles. Und das Unglück, das war der Boden, das waren meine Füße, das Kleid, das ich trug, der Körper, der drinsteckte, der Hals, der Kopf, die Frisur. Sogar die Schuhe.“ (S. 11)
Mit dem erstmaligen Bewusstwerden der Gebrechlichkeit des Lebens meldet sich die Stimme, der das Kind spontan seinen eigenen Namen gibt: Ella. Aus der Distanz von etwa fünf Jahrzehnten deutet die Ich-Erzählerin ihre Erfahrung so:
„Vielleicht hatte ich damals das erste Mal das wirklich zwingende Bedürfnis, über mich zu reden.“ (S. 12)
Fünfzig Jahre später – die Zeit ist “fließbandartig, weder besonders laut noch lautlos“ (S. 12) vergangen – stirbt die Mutter im März, folgenschwer für Ella, denn in den kommenden neun Monaten zerfällt ihr bislang gesichert scheinendes Leben, löst sich ihre Existenz förmlich auf und findet erst in der Dezember-Dunkelheit wieder einen Fixpunkt: Von allem Bisherigen gelöst, von schmerzhaften Trennungen geläutert findet sie in einer neuen Wohnung die Kraft – so die Vermutung des Lesers – ihre Geschichte niederzuschreiben: „Hast du denn nie gedacht, du könntest selbst Figur sein, ich meine Romanfigur?“ fragt die innere Stimme in der Endphase des Buches. Und auch die Anordnung der Möbel lässt auf einen kreativen, dialogischen Schreibakt schließen:
„Meine beiden Stühle stehen einander an einem Tisch gegenüber, ganz so, als bildeten sie Plätze für Ella und mich.“ (S. 309)
Dazwischen liegt die Insel im Maismeer. In drei Abschnitten – „Ein Name, die Mutter, das Begräbnis“, „Die Bibliothek“ und „Insel und Meer“ – wird Ellas Leben erzählt. Geboren im Krieg wird sie von der Not der Zeit und der kärglichen Existenz ihrer Mutter geprägt:
„Nervös und unruhig hatte sie im Kreis der Familie ständig nach einem Lohn für ihr so mageres, in Alltäglichkeiten träge versumpfendes Leben gesucht.“ (S. 13)
Ellas Leben ist alles andere als spektakulär. Zunächst in einer Buchhandlung tätig, dann Bibliothekarin in der Landesbibliothek, erfüllt sie der Beruf nicht. Ihre kinderlose Ehe mit Clemens ist längst erkaltet:
„Clemens und ich, wir lieben uns seit Langem nur noch mit den Augen. Unsere Blicke richten sich, Verständigung versprechend, wie Gerätschaften aufeinander ein.“ (S. 95)
Ein Autounfall am Tag des Begräbnisses ihrer Mutter lenkt ihr Leben in eine neue Richtung: Als sie nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus zum Unfallort zurückkehrt, führt der Weg sie zu einem aufgelassenen Bauernhof inmitten des südsteirischen Maismeeres. Von dem nicht bewohnten, abgesperrten Gehöft wird sie auf geheimnisvolle Weise angezogen, in einen „ekstatischen Zustand“ (S. 65) versetzt:
„Ein leichter Wind streichelte das Gras und bewegte den Mais, wie Finger konnte man die Luft im Feld sich bewegen sehen. Der Himmel war blau. Hellblau. In jeder Hinsicht das, was man einst wohl einen traumtrunkenen Sommertag genannt hätte. War da ein Verlangen? Schon eher ein starker Wille voll Schmerz. Ich dachte an das Haus, dass ich darin wohnen wollte. Ich wusste, ich würde nicht loskommen davon.“ (S. 73)
Sie richtet sich zunächst notdürftig mit einem Schlafsack ein und löst nach der überraschenden Frühpensionierung und Trennung von Clemens ihren bisherigen Wohnsitz in der Hauptstadt auf, aus deren Getriebe sie längst herausgefallen ist:
„Auf der Fahrt in die Bibliothek sah ich den Leuten nach, wie sie hastig Gehsteige wechselten oder plötzlich mitten auf der Straße standen. Schutzlos, aber auch gleichgültig kamen sie mir vor, wie auf unsichtbare Schienen gestellt, die sie irgendwohin in ein Haus, eine Wohnung, ein Geschäft zogen.“ (S. 181)
Das Zusammentreffen mit Janos, dem Mieter des Bauernhofs, und dessen sechsjähriger Tochter bringt wieder pulsierendes Leben in ihren Alltag: eine erfrischend erotische Beziehung zu einem Mann, die ungetrübte Zuwendung eines Kindes und eine vielsagende Beschäftigung mit Geschichte: Janos Hobby führt sie zu einem Steinbruch, wo ihr im Freilegen von Kristallen, versteinerten Schnecken und Muscheln eine vibrierende Sicht vom Wandel des Universums entgegentritt.
Was vielversprechend begonnen hat, bleibt eine Episode: Janos und seine Tochter haben bloß ihren Urlaub auf dem Bauernhof verbracht und kehren in ihr Leben zurück. Den Herbst verbringt Ella in zunehmender Einsamkeit. Da der Hof einen neuen Mieter gefunden hat, ist sie um die Weihnachtszeit gezwungen, eine neue Bleibe zu suchen. Der Aufbruch von der Insel im Maismeer wird zu einem ruhigen, reifen Neubeginn.
Das thematisch dicht gewobene Buch geht vielen jener Fragen nach, die von menschlichen Erfahrungen ausgelöst werden: der Monotonie des Lebens, dem Altern, Abschiednehmen und dem Tod, der Zerstörbarkeit des Menschen und seinen zerstörerischen Anlagen, der Ungerechtigkeit des Lebens, dem In- und Miteinander von Natur und Mensch und schließlich dem Wandel und der Endlichkeit der Welt. All das wird ausführlich erörtert, bevor die Handlung zu einem abschließenden Befund führt. Es ist die Einsamkeit als menschliche Grunderfahrung:
„Es wurde kalt. In den Morgenstunden zogen die Hügel einen scharfzackigen Horizont. Der gläserne Winterhimmel trübte den Nachmittag ein, die Lichtlosigkeit nahm zu, schon verwischte sich, was nahe war. Der Nachbarhof und die Hügel ringsum verschwanden.“ (S. 306)
Eindrucksvoll und stimmig gestaltet Friederike Schwab die erzählte Zeit: Das Keimen, Wachsen und Reif-Werden des Maises bestimmen leitmotivisch den Verlauf der Geschichte, sind Anlass für atmosphärisch starke Beschreibungen. Dass der Rhythmus der Jahreszeiten in der Dunkelheit der Wintersonnenwende verklingt, veranschaulicht zusätzlich den erzählten inneren Prozess.
In der philosophischen Dichte des Romans liegt leider auch seine Gefahr: Hin und wieder verlieren sich Gedankengänge in irritierender Leere, wird das Philosophieren überzogen:
„Ich beschrieb meine Existenz als eine Art Steh- oder Gehvermögen im Raum der Gegenwart, wobei ich Gegenwart jetzt wirklich für etwas Räumliches hielt.“ (S. 228f.)
„Ereignisse verdoppelten sich. Eine andere zweite zeit entstand. Eine lief in die Vergangenheit zurück, eine in die Zukunft voraus. Wie zwei Suchhunde. Ich bekam zwei Gesichter. Jedes in eine andere Richtung.“ (S. 275)
Wortblasen dieser Art werden mitunter zur Schwäche des Textes. Dieser Mangel an Ökonomie und Disziplin betrifft nicht nur die Sprache, sondern auch einzelne Szenen. So fehlt es beispielsweise den Gasthausszenen gegen Ende des Romans sowohl an gediegener Gestaltung als auch an überzeugender Kohärenz.
Anzumerken ist leider auch ein ziemlich flüchtiges Lektorat. Anders sind auffallende Mängel in der Zeichensetzung und etliche Grammatikfehler nicht zu erklären.
Dennoch. Die Lektüre von Friederike Schwabs „Insel im Maismeer“ ist ein Gewinn: Er liegt in der Durchdringung einer lebensnahen Geschichte mit der aufrichtigen Erörterung einiger Grundfragen des Lebens.
Herbert Först
Textprobe:
„Vor vielen Jahren hatte ich in einem Wald einen ähnlich ekstatischen Zustand erlebt: Der Wald war ein Leuchten gewesen. Farbintensiv und dabei doch durchsichtig und klar. Erschreckend schön. Ich war auf dem Waldboden gelegen, und es war wie eine schon immer gekannte und gleichzeitig doch nie erlebte Gegenwart. Aus einem anderen Stoff war der Wald. Immer wieder wiederholte ich: anders und gleich. Durchscheinend, gläsern und zugleich fest, Stämme und Wald: aus Licht. Aus Tönen. Klingend fast. Ich dachte an die Beschreibung von Sphärenklängen. Ich weiß noch, dass ich damals weinend vor Glück in das Hotelzimmer zurückkam, wie ich nachts im Bett den Rücken von Clemens zärtlich berührt hatte. Die Zeit unseres trostlosen Zusammenlebens schien ausgelöscht. Das Schweigen, oder soll ich sagen, die unhörbar hörbare Musik dieser Gegenwart hielt mich fest, ließ mich schweben. Diese Sommernacht glich einem Wandern in einer anderen Wirklichkeit.“ (S. 65f.)
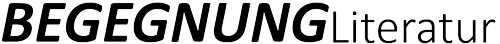
Kommentare sind deaktiviert