„Mit Worten will ich dich finden.“ (S. 29)
In ihrem neuen Roman „Schwedenreiter“ verknüpft Hanna Sukare einen kritischen Beitrag zu Österreichs Nachkriegsgeschichte mit einer Charakterstudie und einer berührenden Liebesgeschichte.
Es ist ein starkes Buch, ein wichtiges, ein mutiges Buch. In ihrem zweiten Roman stürzt sich Hanna Sukare im wahrsten Sinne des Wortes auf das historische Faktum, dass Deserteure aus der Endphase der Nazi-Herrschaft hierzulande kaum jene Rehabilitation, geschweige denn Hochachtung erfuhren, die sie verdient hätten.
Zur Demonstration dieser mehr als irritierenden Gegebenheit schafft sich die Autorin einen hartnäckigen Ich-Erzähler. Er heißt Paul Schwedenreiter, ist von Beruf Brückenmeister in Wien und stammt aus einer fiktiven Salzburger Gemeinde mit dem bezeichnenden Namen Stumpf. Der Duden notiert für das Adjektiv „stumpf“ unter anderem die Bedeutung „ohne Empfindungsfähigkeit“. Im Verlauf der Geschichte wird dieser Ort zum Inbegriff jener geistigen Nachkriegsvernebelung, die Österreich einige Jahrzehnte lang verdunkelte.
Gelegentlich besucht Paul, der von sich sagt: „Ich kenne hier jeden, aber ich kann mit keinem reden.“ (S.13), das leer stehende Haus seiner Urgroßmutter Rosa. Dort hat er mit seiner innig geliebten Meret bis zu deren frühem Tod gelebt. Er betritt die Räume mit einem berührenden Ritual:
„Oh Rosa, Felician, Kaspar, ihr meine Toten, singe ich und schmiege mich in die Verneigungen, ich grüße euch alle in Rosas Haus im Graben von Hinterstumpf.
Sobald ich in Rosas Haus komme, singe ich diese Ankunftslitanei. Der Singsang bringt mir die Räume näher, das Haus, meine Toten. Ich summe noch, als ich zum zweiten Mal in den Oberstock gehe und an der Türschwelle zu einer Kammer stehenbleibe, nur Bett, Kommode und ein Hocker sind drin. Zuerst leise, doch stetig lauter werdend singe ich in der Kammer. Em, em, Emeri, Emere, Emerenzi, ach Renzi, crescendo, Emerenzia, meine Meret, oh Meret, sei gegrüßt in Rosas Haus, ich grüße dich in unserer Kammer, du fehlst mir, singe ich, wohin bist du gegangen?“ (S.10f.)
Mit dieser Begrüßungslitanei charakterisiert sich der Ich-Erzähler als einfühlsamen, trauernden Hinterbliebenen.
Im ersten von insgesamt neun Kapiteln – es ist mit „kopflose Gegend“ überschrieben – werden die Personen der Familie Pauls vorgestellt: die Urgroßmutter Rosa, von Beruf Magd, ihr unehelicher Sohn Felician und dessen Sohn Kaspar, Pauls Vater.
„Ich bin nicht mehr eingerückt.“ (S.16) Dieser Satz Felicians – geschrieben auf einem Zettel, versteckt unter einem Laib Brot und gedacht als Nachricht an seine Mutter – wird Auslöser und schließlich Motor der Geschichte: Im Sommer 1944 desertiert Felician, versteckt sich auf einer Alm und bewirkt damit die Deportation seiner Mutter in ein KZ. Sie überlebt, und auch ihr Sohn entkommt den SS-Schergen auf deren Jagd nach Deserteuren.
Als die Gemeinde Stumpf 2008 eine Ortschronik herausgibt, lässt diese ob ihrer haarsträubenden Geschichtsfälschungen zum Zwecke der „Reinwaschung“ den Ich-Erzähler zu einem Überprüfer der historischen Fakten werden. Im Fokus seiner Recherchen steht der „Gebirgsjäger“, so genannt nach seiner militärischen Einheit. An ihm wird demonstriert, was im Nachkriegsösterreich viel zu oft geschah: Nach einer Karriere als Illegaler, SS-Scherge und schließlich Wehrmachtsangehöriger einer Einsatzgruppe wird er, den auch eine schwere Verwundung nicht zur Einsicht bringt, 1943 Adjutant des Salzburger Gauleiters Gustav Adolf Scheel und ist als solcher maßgeblich beteiligt an den SS-Gräueltaten in der Endphase des Krieges. Nach Jahren intensiver Bemühungen um „Reinwaschung“ erreicht er diese schließlich mit Hilfe einer Intervention der ÖVP Salzburg. Das ernüchternde Ergebnis: 1951 ist er wieder in jenem Beruf tätig, den er vor seinem Eintritt in die SS-Maschinerie ausgeübt hat. Er ist Volksschullehrer, gilt in seiner Heimatgemeinde als unbescholten und versteht es, sich in der Chronik 2008 sogar als Retter von Stumpf darzustellen, dem es im Frühjahr 1945 gelungen sei, einen SS-Vergeltungsüberfall auf das Dorf zu verhindern.
Wohltuendes Gegengewicht zu solch schmählichen Vorgängen ist der Ausklang des Romans: Obwohl der Bürgermeister einen Gedenkstein für die Deserteure des Dorfes nicht zulässt, wird zur Erinnerung an die „mutige Feigheit“ (S.168) jener Männer, die von manchen nach wie vor als „gefährliche Landplage“ (S.23) bezeichnet werden, auf dem Grundstück von Rosas Haus ein von Granitsteinen umgrenzter Platz geschaffen: „Wie ein Hain ist er, licht.“ (S.170)
Soweit der vordergründige Plot. Stärker als dieser lesen sich die Charakterstudie des Ich-Erzählers und die Liebesgeschichte. In ihnen liegt auch die poetische Kraft des Romans, die – textsortenbedingt – im Bericht über die „Gebirgsjäger“-Recherchen dünner ausfällt. –
Pauls Leben bewegt sich zwischen zwei Welten: In „Rosas Haus im Graben von Hinterstumpf“ (S.10) widmet er sich als „letzter Schwedenreiter“ (S.15) seinen verstorbenen Vorfahren und legt zu diesem Zweck ein „Totenbuch“ an. Nach abgeschlossener Schlosserlehre ist er nach Wien gezogen, ohne die Einsamkeit seiner bisherigen Existenz in Stumpf zurücklassen zu können:
„In Wien, glaubte ich, würde ich wie ein weißes Blatt Papier sein, als machte mich die Stadt nicht nur frei von Stempeln, sondern schenkte mir eine zweite Geburt. Und doch war mein erstes Wiener Jahr ein dunkles. An manchen Tagen schabte die Einsamkeit mein Brustbein.“ (S.35)
Zwei Jahre nach Merets frühem Tod – dreizehn Jahre hat er mit ihr in Wien zugebracht – ist der Zauber ihrer tiefen und zarten Beziehung immer noch lebendig:
„In den ersten Jahren nannte mich Meret Libellchen und sagte lachend, sprich nur ein Wort, dann wird meine Seele gesund. (…) Mit Worten will ich dich finden, sagte sie, und du wirst mich finden. Ich finde leichter Töne, erwiderte ich. Ich komme aus dem Graben, dort sind Worte rar. Mit einem Lahmen willst du auf dem Hochseil tanzen. Ja, sagte sie, mit dir will ich tanzen.“ (S.29)
Viel zu früh stirbt Meret an „einem Tag im Frühjahr“ (S.30). Die Leere, die ihr Tod in seinem Leben hinterlässt, verstärkt seinen Wunsch sich abzuschließen.
„Eine Nacht verbringe ich in ihrem Kleiderschrank, dort ist noch ihr Geruch. Die Blüten draußen und das Gezwitscher bedrücken mich. Es kommen Tage, da wird meine Sehnsucht ein Körperschmerz. Ich verdunkle die Räume, nur nachts öffne ich die Fenster und lasse erst am Ende des Sommers manchmal Licht ein.“ (S.31)
Leo, ein Franziskanerpater, lockt Paul etwas aus seiner Einsamkeit und öffnet ihm eine Tür zur Literatur, indem er ihm „Frost“ in die Hände drückt. Thomas Bernhards Roman verdichtet und variiert gleichsam den „Gebirgsjäger“-Handlungsstrang. Verweise auf Franz Innerhofers „Schöne Tage“ und Peter Handkes „Über die Dörfer“ werfen ein erhellendes Licht auf die literarische Sozialisation der Autorin und stellen den Roman in einen reizvollen Kontext mit der österreichischen Nachkriegsliteratur.
Hanna Sukares Roman überzeugt mit seinem Plot, er ist strukturell stimmig gebaut und sprachlich einfühlsam gearbeitet:
„Eine Trauer erfasst mich. Meine Recherchen über den Gebirgsjäger hatten mich oft verstört, ich hatte die Dokumente dann in einen Ordner geheftet und meine Arbeit daran für Wochen, manchmal für Monate unterbrochen. Die Trauer ist anders, ohne Trost. Mein Boden ist nicht mehr sicher. Ich bin Brückenmeister, ich bin der Enkel eines Deserteurs, ich fühle mich meinem Vorhaben, die Laufbahn des Gebirgsjägers zu erforschen, nicht mehr gewachsen. Ein Draht geht durch meine Kehle und um mein Herz. Ich habe Angst.“ (S.116)
Besonders hervorzuheben ist das motivische Gewebe, das die drei Handlungsstränge verbindet. Es wurzelt in Pauls beruflicher Arbeit:
„Die Brücken und Tunnels, für die ich zuständig bin, untersuche ich wie ein Hausarzt, handnah: mit Augen, Ohren, Händen.“ (S.37)
„Ich bin Brückenmeister und deshalb Rissexperte. Sehe ich ein Bauwerk, nehme ich unwillkürlich dessen Risse wahr.“ (S.46)
„Risse“ in Tunnels und an Brücken werden zum verdichtenden Motiv:
„Alle sechs bis acht Meter hat die Tunnelwand einen Längsriss, harmlose Zwangsrisse, die der Beton zu seiner Ausdehnung braucht.“ (S.45)
„Meret ist aber vor zwei Jahren gestorben. Ihr Tod zerriss die Fäden, die sie im Graben zu meinem Schutz um mich gezogen hatte.“ (S.14)
Und die Frage „Wie umgehen mit den Nachkommen der Deserteure?“ zeitigt Risse in Stumpf: „Und so durchziehen die Risse (…) etliche hiesige Familien“ (S.51), schreibt Pauls Freund Pertil. Das ist kunstvoll gewobene Textarbeit, die gute Literatur auszeichnet. –
So hart und kompromisslos Hanna Sukares Beitrag zur Nachkriegsgeschichte Österreichs ist, so versöhnlich wirkt die Schlussszene. An die hundert Menschen und einige Musiker haben sich beim „Gedenkhain“ eingefunden:
„Leo spricht zum Gedenken. Wir schweigen.
Später ist der Platz menschenleer. Ich säe Gras.“ (S.170)
Zuversicht spricht aus diesen letzten vier Sätzen, denn sie deuten an, dass die Beschäftigung mit der Vergangenheit den Boden für neues Leben bereitet.
Textprobe:
„Wir schwiegen viel und oft sangen wir miteinander. Unser Singen zähle ich zu unserem Schweigen, könnte aber ebenso gut sagen, beides war Teil unseres Gesprächs. Im Schweigen waren unsere Blicke und Gesten, in das Singen kam oft Lachen. Unsere Nähe brauchte ich nicht prall von Worten. Mit Meret war ich einverstanden, nichts an ihr wünschte ich mir verändert, ich schaute sie gern an. Sie nahm mir nicht übel, wenn ich auf ihre Wortsehnsucht antwortete: Nach der Balz schweigen die Vögel. Schon Anfang Juli wird ja der Wald stimmlos, im August ist mir an dumpfen schwülen Tagen die Waldstille mitunter unheimlich. Auch wenn wir viele Stunden stumm miteinander verbrachten, hatten wir nach unserem ersten gemeinsamen Jahrzehnt doch alles gesagt, was zwei Leute einander sagen können, und zogen uns ohne Groll ein wenig voneinander zurück, lebten Seite an Seite, und die wortlosen Stunden wurden Stunden für sie und für mich, wir gingen unseren Gedanken nach, dachten wenige zu Ende, machten Pläne oder beträumten unser Leben. Seit je konnten wir die Gedanken des anderen erraten, und nach und nach geschah es häufiger, dass wir zum gleichen Satz gleichzeitig ansetzten und ihn nicht zu Ende sprachen, weil unser Gelächter solche Gleichzeitigkeit abbrach.“ (S.29f.)
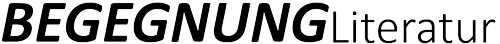
Kommentare sind deaktiviert