„Das Leben ist schlecht gefedert“
Hannelore Valencaks Absage an sentimentale Lebensentwürfe
Die Bruchlinie zwischen Nacht und Tag, zwischen Träumen und Wachen gilt spätestens seit Kafkas „Verwandlung“ als jener „Augenblick, in dem alles möglich ist“ (S. 5), und bietet sich an als Ausgangspunkt für Geschichten über die Rätselhaftigkeit menschlicher Existenz. Ähnlich Gregor Samsa wacht Ursula an einem Julimorgen auf und stellt fest, dass ihr Traum in die Realität gekippt ist, dass es nicht der erwartete Morgen ist, an dem sie mit ihrem geliebten Joachim den Sommerurlaub antreten wollte, sondern ein klirrend kalter siebenter Februar, ein Tag, der sie in die Vergangenheit zurückwirft. In ihrem im Residenz Verlag aufgelegten Roman „Das Fenster zum Sommer“ greift die 2004 verstorbene und weitgehend vergessene Hannelore Valencak dieses Motiv virtuos auf und eröffnet einen Spannungsbogen, der fortan Motor der Handlung bleibt.
Was tun an einem Sommermorgen „mit dem Gefühl, es müsse Winter sein“, weil „das Licht (…) so weiß und ausgefroren und zu zaghaft für das Licht eines Julimorgens“ (S. 5) ist? Nach anfänglichem Widerstand gegen das, was ihr widerfährt, akzeptiert Ursula diese Zeitreise und damit die Aufgabe, einen Lebensabschnitt noch einmal zu durchlaufen, und das in vollem Bewusstsein all dessen, was sie schon erlebt hat. Was folgt, ist die detailgetreue Schilderung eines bedrückend engen Frauenlebens: Ursula lebt bei ihrer Tante Priska, einer ich-zentrierten, tyrannischen Frau, die ihrer Nichte unerbittlich das Gefühl gibt, dankbar sein zu müssen:
„In den letzten Jahren hatte ich manchmal daran gedacht, mir in Geroldstadt eine kleine Wohnung zu kaufen, doch jedesmal schrak ich von neuem davor zurück, was für eine Fracht an schlechtem Gewissen mir Tante Priska mit auf den Weg geben würde.“ (S. 73)
Ursula arbeitet in einem Büro als Übersetzerin: auch dort Enge, Trostlosigkeit und Dumpfheit in hierarchischen Strukturen. Sie begegnet Joachim, einem engelgleichen Wesen; die beiden heiraten, beziehen ein geräumiges Haus mit Garten, sind glücklich. Ursulas Gefangenschaft bei Tante Priska hat ein märchenhaftes Ende gefunden. Ihr Glück währt aber nur bis zu jenem Julimorgen, bis zu jenem „Sturz in die Vergangenheit“ (S. 21), den sie nicht wahrhaben will: „So zog es mich hinein in jene gespenstische Welt, die so hartnäckig darauf bestand, die Wirklichkeit zu sein.“ (S. 18) In Panik will sie nur eines: fliehen: „Nun stand ich auf der Straße im beißenden Februarfrost. Das Denken war für Sekunden ausgelöscht. Es schüttelte mich vor Panik. Fort! Nur fort von hier!“ (S. 13) – und wieder meldet sich Kafka im Hintergrund, diesmal mit einer Anspielung auf die Parabel „Der Aufbruch“. Am Abend dieses quälenden Tages hofft sie noch auf den „Rückweg im Schlaf“ (S. 47) – vergeblich! Was immer sie unternimmt, ein Zurück ins Glück mit Joachim gibt es nicht. Immer wieder stößt sie an rätselhafte Wände: „Hier durfte (sie) nicht weiterdenken, es war verboten, die Sache ergründen zu wollen.“ (S. 14) Erst nach einigen schmerzvollen Versuchen, Joachim zu treffen, erkennt sie, dass sie ihr Schicksal nicht lenken kann, sondern gewähren lassen muss:
„Ich hatte keine Angst mehr, den Weg zu verfehlen, jenen Weg, der aus dem Schnee in den Sommer führte. Im Spätwinternebel war ein Geruch nach Gras, nach Lindenhonig und blühenden Vorstadtgärten. Joachim hatte mich nicht im Stich gelassen. Er ging unbeirrt, wenn auch blind, auf unseren Treffpunkt zu, verläßlich und treu, wie er immer gewesen war.“ (S. 167)
Ihren Erinnerungen gehorchend lebt sie nun auf den Tag der Begegnung mit Joachim zu, verfehlt ihren Geliebten aber, da ihr Taxi im Abendstau der Großstadt nicht schnell genug vorankommt. In tiefer Resignation akzeptiert sie, was ihr widerfahren ist. Schließlich erfährt sie, dass Joachim in der Nacht vor ihrem „Erwachen“ einem Herzschlag erlegen ist. In einem längeren Gespräch formuliert ein Arbeitskollege für Ursula und die LeserInnen Ansätze zur Deutung der rätselhaften Zeitreise; an dieser gereift, ist Ursula nun fähig, sich auf neue Perspektiven einzulassen.
Die Welt, in die wir geführt werden, trägt Züge der Städte und Dörfer der Sechziger Jahre, dennoch treffen wir mit wenigen Ausnahmen – der Name Ruprechtskirche verweist auf Wien – auf keine vertrauten Namen; das trägt dazu bei, dass die surreale Geschichte von einer Aura der Unheimlichkeit durchweht wird, die hin und wieder alptraumhaft beklemmend wirkt.
Erzählt wird die Geschichte von einer jungen Frau, die – und das zeichnet den Text aus – auf den ersten Blick nicht das Zeug zu einer Romanheldin hat: kleinbürgerliches Milieu, triste berufliche Umgebung, schlichter Charakter. Warum lässt man sich dennoch auf sie ein? Es ist ihr verzweifelter Kampf ums Glück, der zum Lesen anregt, an dessen Ende sie resignierend einsieht: „Dieses Leben, von dem die Rede ist, ist von der Art, wie es die meisten führen. Ich habe keinen Anspruch auf Sonderbehandlung.“ (S. 241)
Schreibende Frau, Erscheinungsjahr 1967 – das lässt emanzipatorische Ansprüche erwarten; sie sind auch da, werden aber auf paradoxe Art wieder aufgehoben: Da ist eine junge Frau, die ein Recht auf ein Leben in Selbstbestimmung und materieller Sicherheit zu haben glaubt, ihr „Glück“ aber über einen Märchenprinzen definiert, den sie abgöttisch verehrt:
„Das Leben mit ihm war einfach gewesen und leicht wie ein Tag zur Zeit der Lindenblüte. Ich ging vor mich hin, und es war ein Gesumm in den Bäumen. Jemand war da, der besorgte das Atmen für mich, hob meine Schwere auf, und ich tat das gleiche für ihn.“ (S. 60)
„Zeit der Lindenblüte“ – leitmotivisch arbeitet die Autorin mit der Linde, diesem uralten Symbol des Beschützens und Heilens, wenn ihre Ich-Erzählerin von der verwandelnden Kraft der Liebe spricht. Doch Ursula kommt Joachim, ihr „Fenster zum Sommer“, abhanden, sie stürzt zurück in den Winter. Darauf läuft aber der Text hinaus: Im Scheitern dieses mann-zentrierten Glücks liegt die emanzipatorische Botschaft der Autorin.
Hannelore Valencak geht in ihrer epischen Reflexion über menschliches Glück eine Dimension weiter, stellt es unter einen fordernden ethischen Anspruch und deutet damit eine weitere Ursache für das Scheitern an:
„Die Freude hatte uns lebensblind gemacht. Das Leid und die Verzweiflung anderer Menschen hatten uns nicht stärker berührt als Kriege in fernen Ländern. Wir hatten uns als freie Bürger des Sommers gefühlt, denen ein hundertjähriger Friede gewiß war.“ (S. 41)
In letzter Konsequenz ist „Das Fenster zum Sommer“ – und hier sei zum dritten Mal Kafka erwähnt – eine sprachkünstlerische Auseinandersetzung mit der Rätselhaftigkeit des Lebens:
„Im Hof befand sich niemand und nichts. Da waren vier Wände und endlose Fensterreihen. Ich sah Köpfe hinter den Fenstern, Gestalten, die sich bewegten, und ich fand keinen Sinn in alledem. Kein Plan war daraus zu ersehen und keine Zusammenhänge.“ (S. 55)
In all diese absurde Trostlosigkeit setzt die Autorin die schöpferische Kraft des menschlichen Geistes, dem Verwandlung möglich ist:
„Jetzt sah ich von oben in die Gärten hinein. Sie hatten nichts herzuzeigen als den Schnee und die zusammengeflickten Hütten. Doch stand es mir frei, sie im Geist mit allerlei Grünem zu schmücken. Ich versagte dem vielen toten Weiß das Recht, sich gegen mich durchzusetzen, und stellte kühn einen Dahlienbusch hinein. Ich ließ Malven, Phlox und allerlei Rosensorten blühen und umspann die Bretterbuden mit wildem Wein. An die Gartenränder kamen Hirtentäschchen, Breitwegerich und Hundskamille. Schon flogen Bienen herbei, um Honig zu suchen. Dann teilte ich an die kleinen Gärten ihre Sonnenblumen aus, so daß jeder wenigstens eine bekam, eine ernste, freundliche Wächterin. Als ich sah, daß es gut war, trat ich vom Fenster zurück …“ (S. 108)
Geprägt wird der Text von der Spannung zwischen schmucklosem Realismus und sentimentaler Wunschwelt. Diese „doppelte Welt“ bestimmt nicht nur den Plot, sondern auch die Sprache und die Erzähltechnik in ihrem Ineinander von erlebendem und erzählendem Ich. Ursula bezahlt ihre Sentimentalität, die sie glauben macht, dass Leben auf das Glück in einer erfüllenden Partnerschaft reduzierbar ist, mit Verstörung, Schmerz und bitterer Ernüchterung. Erst mit dem Hintergrund dieser Deutung erklärt sich die häufige Gratwanderung zwischen schlichter Prosa und sentimentalen Passagen:
„Ich fühlte, wie viel Raum es in mir für die schönen Dinge des Lebens gab. Dieser Raum war schon einmal erfüllt und bewohnt gewesen. Es hatte in mir ein Beet voll Rosen geblüht, ein Birnbaum hatte Flocken abgeschüttet, und allerorten war der Grassamen aufgegangen, sogar auf dem frisch mit Kies bestreuten Weg. Jeden Abend war Joachim heimgekommen, und es gab immer Gründe genug, darüber froh zu sein. Und die vielen schönen Dinge, die wir erlebten, gingen durch offene Türen aus und ein, …“ (S. 76)
Solche Anklänge an Kitsch erklären sich in der Regel aus dem Konzept des Romans, aus der doppelten Welt der Ich-Erzählerin. Allerdings finden sich auch Sätze, deren Banalität sich durch nichts erklären lässt, die mitunter auch erzähltechnisch nicht nachvollziehbar sind:
„Die Torte war wirklich gut und desgleichen der Kaffee. In alledem war viel Überzeugungskraft.“ (S. 123)
„Ich war ganz leer und ohne einen Gedanken. Auch mein Blick muß leer und ratlos gewesen sein. Dann spürte ich, wie diese Leere in mir sich von innen her mit etwas Heißem füllte – mit Wellen von ungestüm pulsierendem Blut.“ (S. 139)
Passagen dieser Art und die Tendenz zu Wiederholungen lassen den Text stilistisch unausgewogen werden, verlangen beim Lesen trotz des vorantreibenden Spannungsbogens manchmal einiges an Ausdauer.
Doch zurück zur Ich-Erzählerin. Warum lässt Hannelore Valencak diese junge Frau so schmerzhaft scheitern? Es ist legitim, bei der Antwort Ingeborg Bachmann ins Spiel zu bringen: Hannelore Valencak, die um bloß drei Jahre jüngere, aus der Steiermark gebürtige, ab 1962 in Wien lebende Autorin, erzählt uns eine Geschichte, die schonungslos zum Ausdruck bringt: Das Fenster zum Sommer ist nicht mehr als ein Fenster, und es wäre kühn, ja unangemessen, eine Tür zu erwarten. Mit dieser Erkenntnis liegt sie auf Ingeborg Bachmanns programmatischem Leitsatz, dass die Wahrheit dem Menschen zumutbar ist. In einer Zeit, die von billigen Glücksversprechen überquillt, ist dieser Roman eine wertvolle Studie über das menschliche Glück, ihn wieder der Öffentlichkeit zugänglich zu machen ein Unterfangen, das Anerkennung verdient.
Herbert Först
Textprobe:
Joachim wohnte schon lange in unserer Stadt, und es gab keine Verbindung mehr zwischen ihm und mir. Und doch waren schon in der Stille die Kräfte am Werk, die uns eines Abends veranlassen würden, die gleiche Straßenbahn zu besteigen und, so wie damals, nebeneinanderzustehen. Vielleicht wurden schon Taten vollbracht und Worte gesagt, durch die dieser Augenblick für uns vorbereitet wurde. Die Allee, in der sich der Raumpunkt befand, der jenem Zeitpunkt zugeordnet war, und durch die ich täglich heimfuhr, wurde grün. Die Blätter entsprangen, entrollten sich und breiteten sich im Licht der Sonne aus. Sie wuchsen in ein Muster hinein, das unsichtbar vorgezeichnet war, und auch nicht einem war es erlaubt, von seinem Bauplan abzuweichen. Sie webten an der Szenerie, an der Kulisse für meine Schicksalssekunde – langsam, genau und ohne Ungeduld. Ich spürte, sooft mein Blick auf sie fiel, die Kraft, die in ihnen gespeichert war, und ich ahnte die magische Kraft, die im Warten liegt. (S. 217f.)
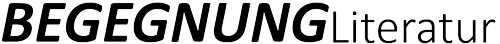
Kommentare sind deaktiviert